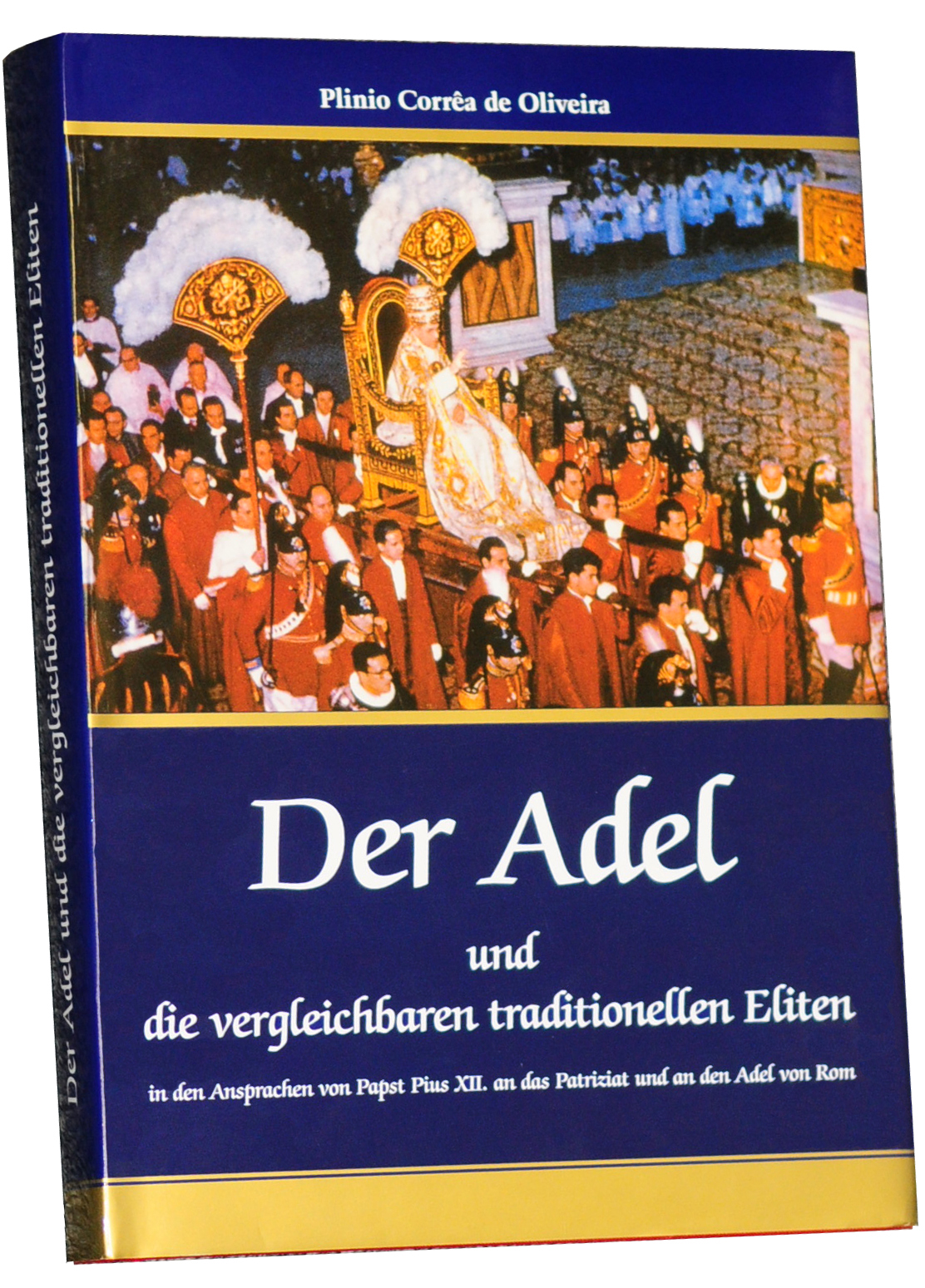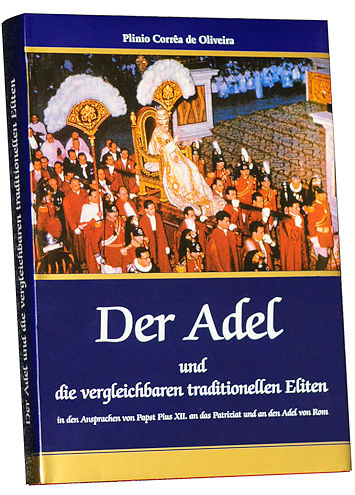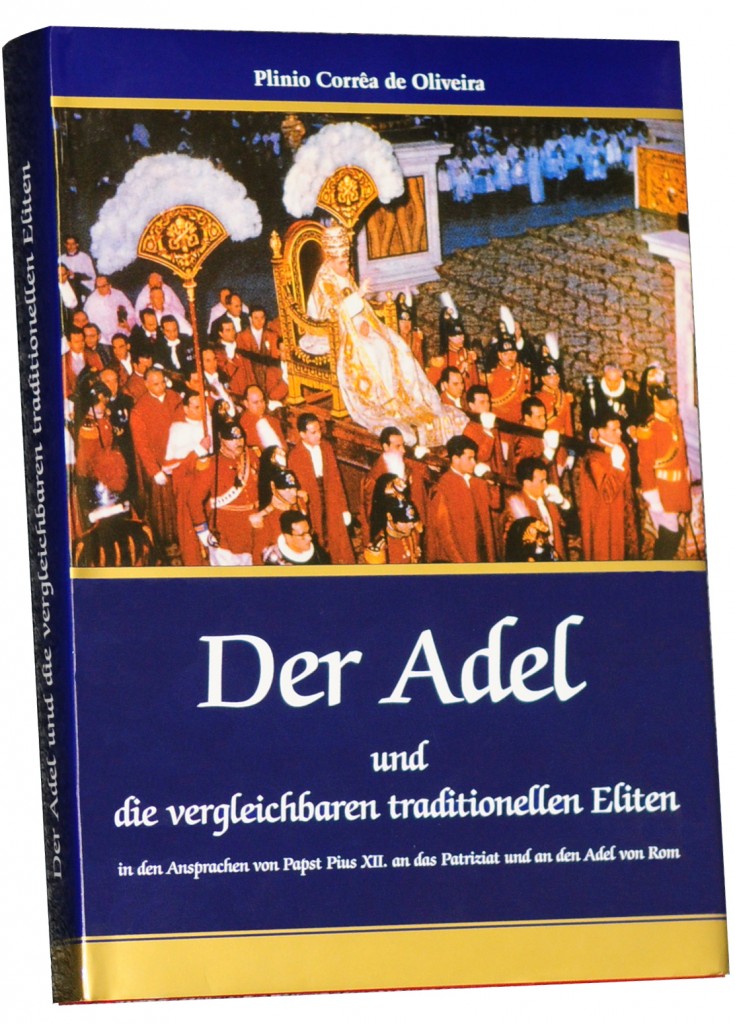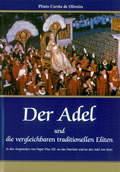KAPITEL II
Die universelle Reichweite der Ansprachen Papst Pius´ XII.
an das Patriziat und an den Adel von Rom
Lage des italienischen Adels während des Pontifikats Pius´ XII.
Die italienische Verfassung von 1947 erklärte die Adelstitel für abgeschafft.1 Sie hat damit der rechtlichen Lage eines tausendjährigen Standes, der heute als gesellschaftliche Wirklichkeit so lebendig wie eh und je ist, den Gnadenstoß erteilt. Damit war ein in jeder Hinsicht komplexes Problem geschaffen.
Die Komplexität dieser Frage hatte sich bereits vorher bemerkbar gemacht. Im Gegensatz zum Adel anderer europäischer Länder, wie etwa Frankreichs und Portugals, ist die Zusammensetzung des italienischen Adels höchst ungleichartiger Natur. Das ist darauf zurückzuführen, daß vor der politischen Vereinigungsbewegung der Apenninischen Halbinsel im vergangenen Jahrhundert die verschiedenen Herrscher, die ihre Macht über irgendeinen Teil Italiens ausübten, in ihrem jeweiligen Herrschaftsbereich auch Adelstitel verliehen haben. Da gab es die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die Könige von Spanien, beider Sizilien, von Sardinien, die Großherzöge der Toskana, die Herzöge von Parma und viele andere. Dazu kamen die Patriziate von Städten wie Florenz, Genua und Venedig und vor allem auch die Päpste, die als weltliche Herrscher eines relativ ausgedehnten Staates ebenfalls Adelstitel verliehen und uns in der vorliegenden Studie natürlich am meisten interessieren. Die Verleihung von Adelstiteln durch die Päpste reichte bis in die Zeit hinein, als ihre weltliche Macht über den früheren Kirchenstaat de facto bereits aufgehoben worden war.

Sog. Livius der Sorbonne
Als es 1870 zur Einigung Italiens kam und die Truppen von Piemont Rom besetzten, versuchte das Haus Savoyen die verschiedenen Adelstraditionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Doch diese Absicht scheiterte sowohl an politischen als auch an rechtlichen Hindernissen. Viele adelige Familien hielten den abgesetzten Herrscherhäusern, denen sie ihre Adelstitel verdankten, die Treue. Vor allem bestand ein bedeutender Teil der römischen Aristokratie darauf, weiterhin traditionsgemäß und offiziell an den Feierlichkeiten im Vatikan teilzunehmen und weigerte sich, den Anschluß Roms an Italien anzuerkennen; jede Art von Annäherung an den Quirinal wurde von diesen Adeligen abgelehnt, die überdies zum Zeichen des Protestes ihre Salons schlossen. Man bezeichnete sie damals wegen ihres Trauerflors als den Schwarzen Adel.
Gesellschaftlich kam es jedoch infolge von Heirat und sonstigen Beziehungen zu einer beträchtlichen Vermischung, so daß der italienische Adel heute unter mancherlei Gesichtspunkten als ein Ganzes angesehen werden kann.
Der Lateranvertrag von 1929 sicherte jedoch in seinem Artikel 42 dem römischen Adel eine Sonderstellung zu, denn er gestand dem Papst das Recht zu, weiterhin Adelstitel zu verleihen, und erkannte auch die bis dahin vom Heiligen Stuhl verliehenen Titel an.2 Damit bestanden der italienische und der römische Adel gesetzlich weiterhin – und inzwischen befriedet – nebeneinander.
In dem 1985 zwischen dem Heiligen Stuhl und der italienischen Republik unterzeichneten Konkordat wird auf dieses Thema in keiner Weise eingegangen.

Prinz Umberto II von Savoyen mit Prinzessin Maria und Prinzessin Giovanna im Vatikan, Mit Markgraf Don Giovanni Battista Sacchetti.
Die Lage des italienischen Adels – wie übrigens des europäischen Adels im allgemeinen – wies auch durchaus komplexe Aspekte auf.
Im Mittelalter bildete der Adel eine Gesellschaftsschicht innerhalb des Staates, der besondere Aufgaben und damit auch bestimmte Ehren sowie entsprechende Auflagen zukamen.
Im Laufe der Neuzeit wandelte sich dieser Zustand immer mehr infolge des Verlustes an Kraft, Glanz und Farbe, so daß bereits vor der Revolution von 1789 der Unterschied zwischen dem Adel und dem gemeinen Volk bedeutend weniger prägnant war als im Mittelalter.
Mit den egalitären Revolutionen des 19. Jahrhunderts erfuhr die Stellung des Adels wiederholt Verstümmelungen. Das ging so weit, daß von der politischen Macht des Adels im italienischen Königreich am Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr übriggeblieben war, als eine prestigeträchtige Tradition, der jedoch eine große Mehrheit der Gesellschaft Respekt und Zuneigung zollte. Diesem Überrest versuchte die republikanische Verfassung dann den Todesstoß zu geben.3

Die Familie Umberto II. von Savoyen im Vatikan
Während so die politische Macht der Aristokratie mit der Zeit immer weiter abnahm, ging auch ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung zurück, wenn auch nicht so schnell. Mit seinen Gütern in Stadt und Land, seinen Schlössern, Palästen, Kunstschätzen, herausragenden Namen und Titeln sowie wegen des ausgezeichneten sittlichen und kulturellen Wertes seiner traditionellen häuslichen Umgebung, seiner Manieren und seines Lebensstils stand der Adel zu Beginn des Jahrhunderts immer noch an der Spitze der Gesellschaftsordnung.
Die vom Ersten Weltkrieg verursachten Krisen veränderten dieses Bild jedoch teilweise. Manche Adelsfamilie stand nun plötzlich mittellos da, so daß sich die Familienmitglieder gezwungen sahen, sich durch die Ausübung von Berufen, die keineswegs im Einklang mit ihrer Geisteshaltung, ihren Gewohnheiten und ihrem gesellschaftlichen Klassenprestige standen, auf würdige und ehrbare Weise ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Andererseits schuf die zunehmend vom Finanzwesen und von der Technik bestimmte Gesellschaft von heute neue Beziehungen und Situationen sowie neue Mittelpunkte gesellschaftlichen Einflusses, die normalerweise nicht zum Bild der klassischen Aristokratie passen. So entstand neben der alten, noch lebendigen Ordnung der Dinge, eine neue, welche die gesellschaftliche Bedeutung des Adels mehr und mehr zurückgehen ließ.
Zum Nachteil des Adels gesellte sich hierzu schließlich ein wichtiger ideologischer Bestandteil. Die Anbetung des technischen Fortschritts4 und der von der Revolution 1789 gepredigten Gleichheit trugen dazu bei, ein Klima des Hasses, der Voreingenommenheit, der Verleumdung und des Spottes gegenüber dem Adel zu schaffen, weil sich dieser auf die Tradition beruft, die durch Blut und Wiege weitergegeben wird, was bei der egalitären Demagogie den größten Haß auslöst.
Der Zweite Weltkrieg hat bei vielen Adelshäusern zu weiteren, noch schlimmeren wirtschaftlichen Zusammenbrüchen geführt und damit den Ernst der Lage, in der sich der Adel sowieso schon befand, noch verschärft. Eine ganze Gesellschaftsschicht steckte damit in einer akuten Krise. Angesichts dieser Umstände hat sich Papst Pius XII. in seinen Ansprachen an das Patriziat und an den Adel von Rom zur Lage des italienischen Adels in unserer Zeit geäußert. Seine Worte lassen sich aber ebenso auf den europäischen Adel insgesamt anwenden.
1. Dieses besonders dem italienischen Adel gewidmete Kapitel ist zum Verständnis der Gesamtheit der hier kommentierten Ansprachen Pius´ XII. notwendig. Die Ansprachen sind jedoch von allgemeinem Interesse sowohl für die Aristokratien wie auch für die vergleichbaren Eliten aller Länder, wie bereits betont wurde und wie später erneut hervorgehoben wird (vgl. Kap. I, 2; Kap. II, 3).
In dem vorliegenden Werk geht es dem Verfasser um den Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten Europas und Amerikas im allgemeinen. Er veranschaulicht und belegt seine Behauptungen selbstverständlich anhand verschiedener historischer Beispiele, die, was Europa angeht, meistens auf die Adelshäuser Frankreichs, Spaniens, Portugals oder eben auf den Adel Roms Bezug nehmen.
Der Grund dafür ist darin zu sehen, daß eine Ausweitung der Beispiele auf alle europäischen Länder das Buch einfach zu umfangreich machen würde. Dies wäre selbst dann der Fall, wenn der Verfasser seine Sammlung von Beispielen auch nur auf vier der weiteren Länder ausgeweitet hätte, die im Laufe der Geschichte und der Kultur des Kontinents von maßgeblicher Bedeutung waren, nämlich Deutschland, England, Italien, Österreich.
Tatsächlich würde die bewundernswerte Vielfalt des europäischen Adels einen weiteren Band erforderlich machen, in dem all die anschaulichen Beispiele von Entstehung, Aufstieg und Niedergang dieser Adelsgeschlechter zusammenzutragen wären.
2. Im Vertrag vom 11. Februar 1929 heißt es: „Artikel 42 – Italien erkennt durch königliches Dekret die von den Päpsten selbst nach 1870 verliehenen oder in Zukunft noch zu verleihenden Adelstitel an. Es sind die Fälle festzulegen, in denen für die genannte Anerkennung in Italien keine Gebühren abzuführen sind.“ (Raccolta di Concordati su Materie Ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili, Bd. II, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1954, S. 102). Die in diesem Artikel des Vertrages erwähnten „Gebühren“ stellen eine symbolische Abgabe dar, die der italienische Staat zur Anerkennung der Titel und der Adelszugehörigkeit von den Adeligen jener Staaten erhob, die vor der Einigung des Landes bestanden hatten. Die Befreiung von dieser „Gebühr“ bedeutete in gewissen Fällen das einzige, minimale Steuerprivileg, das der Vertrag dem päpstlichen Adel zugestand.
3. Angesichts ihrer Bedeutung für das Verständnis der hier kommentierten päpstlichen Ansprachen an das Patriziat und an den Adel von Rom und gewissermaßen an den ganzen italienischen Adel, ist es hier wohl angebracht, kurz auf die Lage des Adels im Zusammenhang mit den verschiedenen Verfassungen im geeinigten Italien, d. h. sowohl während der Monarchie als auch in der Republik, einzugehen. Das bis 1947 geltende Albertinische Statut entsprach dem am 4. März 1848 von König Karl Albert erlassenen Grundgesetz des Reiches von Sardinien. Dieses Statut trat nach und nach in all jenen Staaten in Kraft, die diesem Reiche angeschlossen wurden und ging schließlich in die Verfassung des geeinten Italiens ein. Zu den Adelstiteln war darin folgendes vorgesehen:
„Artikel 79 – Die Adelstitel bleiben denen erhalten, die sie rechtmäßig besitzen. Der König kann neue Titel verleihen.
Artikel 80 – Niemand darf Auszeichnungen, Titel oder Unterhaltsgelder von einer ausländischen Macht entgegennehmen, es sei denn mit Genehmigung des Königs.“ (Statuto del Regno, annotato dall’ avvocato Carlo Gallini, Unione Tipografico Editrice, Turin 1878, S. 102.)
Die italienische Verfassung aus dem Jahre 1947 hinwieder legt in ihren Übergangs- und Schlußbestimmungen fest:
„XIV – Adelstitel werden nicht anerkannt. Die vor dem 28. Oktober 1922 benutzten Prädikate gelten als Teil des Namens. Der Mauritius-Orden wird als Spitalsträger beibehalten und kann als solcher seine Tätigkeit nach Gesetzesvorgabe weiterführen. Das Gesetz regelt die Auflösung des Wappenamtes.“ (Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, Nr. 298, 27.12.1947, S. 45/46).
Das „Adelsprädikat“ setzt sich aus dem Namen des früheren Herrschaftsgebietes und dem Beinamen der Familie zusammen (z. B. Fürst Colonna di Paliano). Die Verfassung von 1947 erlaubt, daß in Urkunden der zusammengesetzte Name gebraucht wird, vorausgesetzt, daß dieser vor der Machtübernahme des Faschismus’ gebräuchlich war.
Das „Wappenamt“ der monarchischen Zeit war ein Sondergericht, das in Titel- und Wappenfragen zu entscheiden hatte. Heute entspricht dieser Einrichtung das italienische Adelskorps, dessen Entscheidungen zwar keine gesetzliche Kraft haben, das jedoch ein hohes moralisches und historisches Prestige genießt. Es entscheidet über die Zulassung von Mitgliedern zu Vereinigungen wie dem Malteser-Orden, dem Jagdkreis, dem Schachkreis usw. Weder in der alten noch in der neuen italienischen Verfassung werden dem Adel irgendwelche Vorteile politischer oder steuerlicher Natur eingeräumt, denn nach dem Albertinischen Statut wird der Adel nur noch als Reminiszenz der Vergangenheit anerkannt.
4. Leser, denen dieser Ausdruck übertrieben erscheinen mag, tun gut daran, die Stellungnahme Pius´ XII. in seiner Weihnachtsansprache des Jahres 1953 kennenzulernen (vgl. Kap. V, 3c).
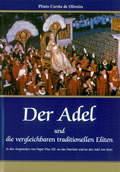
Kaufen Sie das Buch
Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen Pius’ XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom von Plinio Corrêa de Oliveira, Kapitel II, N ͦ. 1.