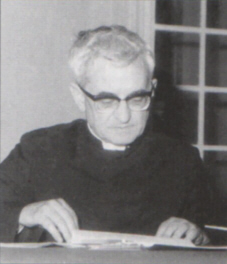Kommentare hoher geistlicher Würdenträger und bedeutender Persönlichkeiten
Alfons M. Kardinal Stickler, S.D.B.

Sehr geehrter Herr Professor,
Ihr Werk „Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“, das Sie mir in italienischer Übersetzung gesandt haben, ist ein großes Geschenk.
Es hat mich aus verschiedenen Gründen sehr beeindruckt:
Erstens durch seine Aktualität. Es bestätigt, daß die Lehren des großen Papstes Pius XII. nach wie vor Gültigkeit haben. Die gegen den Adel gerichteten grausamen Angriffe, die sich durch die französische Revolution auf der ganzen Welt verbreitet haben, klingen jetzt überall ab.
Zweitens wird das Buch in einer Zeit des weltweiten Verfalls vor allem der christlichen Werte in vielen Herzen den Wunsch nach adeligen Eliten wachrufen, die in den letzten Jahrhunderten eine bedeutende und oft entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung dieser Werte gespielt haben. Solche Vorbilder für Menschlichkeit werden jetzt dringend benötigt.
Ein dritter Grund sind Ihre Überlegungen – die mir ganz wesentlich erscheinen -, neben den aristokratischen Eliten analoge Eliten aus den vielen edlen Seelen heranzubilden, die es überall auf der Welt gibt.
Ihre umfassende und stichhaltige Dokumentation ist eine großartige Analyse der sehr komplexen sozialpolitischen Realität unserer Tage. Mit Ihren Kommentaren zu den Ansprachen von Papst Pius XII. bringen Sie zum Ausdruck, was Pius XII. und seine Nachfolger bis zu Papst Johannes Paul II. vom bestehenden Adel und von künftigen vergleichbaren traditionellen Eliten hinsichtlich religiöser Moral und kultureller Reform erwarten.
Verehrter Professor, ich freue mich über Ihr Buch und wünsche ihm eine große Verbreitung. Möge es eine tiefe Sensibilität für die Erneuerung religiöser Moral und gesunder Ethik entfachen und den Menschen vor Augen führen, daß nur echte Werte Frieden, Wohlstand und Glück bringen und garantieren können.
Diesen guten Wünschen schließe ich mein inniges Gebet zu Gott und der Mutter der Kirche an, damit Ihr Werk, das für die heutige Zeit so wichtig ist, Unterstützung finden möge.
In Christus
Alfons M. Kardinal Stickler, S.D.B.
eh. Vorstand der Bibliothek des Vatikan
Mario Luigi Cardinal Ciappi , O.P.
Sehr geehrter Herr Professor,
die Worte des Lobes und der Bewunderung von Fr. Victorino Rodriguez, O.P., einem der berühmtesten Theologen unserer Zeit, haben mich veranlaßt, Ihr Buch „Der Adel und die vergleichbaren Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“ mit großem Interesse zu lesen.
Die vierzehn großartigen Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom wurden von vielen nicht so sehr als theologisches, philosophisches und historisches Werk bezogen auf jene Werte, die bisher eine grundlegende und zeitlose Rolle spielten, gesehen, sondern vielmehr als eine nostalgische Vorliebe für Tugenden, Größe und Ruhm, wofür die Welt immer weniger Verständnis hat.
Die letzte dieser Ansprachen stammt aus dem Jahr 1958. Mehr als 30 Jahre später stellt sich nun heraus, daß Pius XII. den Lauf der Ereignisse richtig vorausgesehen hat. Die Angriffe, denen der Adel ausgesetzt war, lassen allmählich nach, und die Zahl prominenter Intellektueller, die ihre Stimme erheben, steigt ständig. Sie weisen darauf hin, wie nachteilig sich der Verlust authentischer Eliten auf Kultur und Lebensstil der heutigen Gesellschaft auswirkt und auch eine Herabwürdigung der Menschen zur Folge hat. Es zeigt sich nun ein leidenschaftliches Streben nach Wiederherstellung des Einflusses authentischer Eliten auf das einfache Volk, sodaß letzteres – in Übereinstimmung mit den Ansprachen Papst Pius XII. – wieder seine Menschenwürde erhält und nicht eine namenlose Masse darstellt (Weihnachtsbotschaft seiner Heiligkeit Pius XII., 1944).
In diesem historischen Kontext erweist sich Ihr Buch als sehr aktuell. Mit ihrem bemerkenswert scharfsinnigen, mit den Lehren des Papstes Pius XII. übereinstimmenden Kommentaren rufen Sie den Adel und analoge Eliten auf, mutiger als bisher für geistliche und weltliche Werte und für Gerechtigkeit einzutreten.
Wie dieser große Papst hervorhob, ist es die Aufgabe der Eliten, durch Beispiel, Wort und Tat den Reichtum des christlichen Glaubens zu verbreiten und der Gesellschaft die Gefahr bewußt zu machen, im Chaos und moralischen Elend zu versinken.
Möge die Göttliche Vorsehung Ihrem Buch, das Ihre Gelehrsamkeit und grenzenlose Liebe zur Kirche zum Ausdruck bringt, eine weite Verbreitung zuteil werden lassen und dazu führen, daß sowohl die vorrangige Option für den Adel, die von Papst Pius XII. betont wird als auch die vorrangige Option für die Armen, denen Papst Johannes Paul II. in großer Liebe verbunden ist, besser verstanden wird.
Mario Luigi Cardinal Ciappi, O.P.
em. Päpstlicher Theologe
Silvio Cardinal Oddi
Sehr geehrter Herr Professor,
mit großem Interesse habe ich Ihr Buch “Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“ gelesen.
Sie haben zum richtigen Zeitpunkt die Initiative ergriffen, im Gedenken an den großen Papst Pius XII. dessen Ansprachen der Öffentlichkeit mit entsprechenden Anmerkungen nahe zu bringen. Auch Papst Paul VI. hat nach dem Vatikanischen Konzil darauf hingewiesen, daß die Ansprachen seines Vorgängers an das Patriziat und den Adel von Rom nach wie vor aktuell sind.
Die von Ihren umfangreichen Kenntnissen geprägten Kommentare und die Dokumentation tragen durch Ihre klare Ausdrucksweise zu einem besseren Verständnis des bedeutenden Lehramtes Papst Pius XII. bei. Dies hebt der bekannte französische Historiker Georges Bordonove in seinem Vorwort zur französischen Ausgabe Ihres Buches hervor.
Indem ich Ihr Buch empfehle, bin ich sicher, allen, die sich in die weisen und aufschlußreichen Ansprachen Papst Pius XII. vertiefen wollen, einen großen Dienst zu erweisen.
Ich wünsche Ihrem zeitgemäßen Buch eine weite Verbreitung und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Silvio Cardinal Oddi
Eh. Präfekt der Kongregation für den Klerus
Bernardino Cardinal Echeverria Ruiz
Eine seriöse und objektive Studie der Geschichte zeigt immer wieder, daß alle Kulturen und alle Rassen Unterschiede in ihren Reihen aufweisen, die unbestreitbar sind. Es hat immer gebildete und ungebildete Menschen gegeben, Klassen, die regieren und Klassen, die sich unterordnen, Reiche und Arme. Christus selbst lehrte „die Armen werden immer bei euch sein“. Die Verschiedenheit der Einzelnen innerhalb der menschlichen Gesellschaft ist so natürlich wie die Vielfalt der Organe im menschlichen Körper mit unterschiedlichen Funktionen.
Obwohl diese Verschiedenheit ganz natürlich ist, herrscht die Tendenz, wenn von sozialen Komponenten gesprochen wird, solche Unterschiede als Gegensätze zu betrachten, ähnlich wie Außerirdische zu menschlichen Geschöpfen. Daher tritt die Französische Revolution für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als Fundament der Gesellschaft ein. Im Gegensatz zur christlichen Auffassung, daß alle Menschen gleich sind, weil sie Geschöpfe desselben Gottes und Kinder desselben Vaters sind, wird die irrige Meinung vertreten, daß es unter den Menschen keine wie immer gearteten Unterschiede geben darf. Dieses Leugnen der Verschiedenheit unter den Menschen widerspricht dem Plan Gottes, der das Universum geschaffen hat und entspricht der rationalistischen Theorie, wonach alle sozialen Ungleichheiten eliminiert werden müssen und sei es, wenn nötig, mit Gewalt.
Diese Denkweise charakterisiert die Französische Revolution und hat auch materialistische Soziologen veranlaßt, durch Klassenkampf, Atheismus und Tyrannei all das auszuschalten, was einer Akzeptanz der Unterschiede der Werte förderlich sein könnte, die ein Teil der historischen Realität der Gesellschaft sind. Der Marxismus-Leninismus lehnte die Werte des christlichen Glaubens ab und trat für eine materialistische und atheistische Philosophie ein.
Der Klassenkampf des Marxismus hat durch die Ereignisse in der Sowjetunion einen Todesstoß erhalten. Aber den neuen Plan zur Wiederherstellung der Gesellschaft, die vom historischen Materialismus zerstört wurde, gibt es noch nicht. Es ist daher ein neues Verständnis für das menschliche Wesen erforderlich ebenso wie eine eingehende Studie über die Vielfalt der Werte in der Gesellschaft.
Unter Zugrundelegung interessanter kirchlicher Dokumente hat der scharfsinnige und bedeutende Denker Plinio Corrêa de Oliveira ein Buch geschrieben, das sich mit diesem Thema beschäftigt: „Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“. Der Autor weist darauf hin, daß die Eliten die sozialen Werte der privilegierten Klasse, der Familien mit Tradition und Besitz, zurückerobern müssen.
Einigen wird die Erneuerung der sozialen Werte der Eliten anachronistisch erscheinen. Papst Pius XII. sieht, eingedenk der alten und adeligen Tradition seiner eigenen Familie, im Reichtum an Tugenden den größten Schatz nicht nur für Eliten sondern für die ganze Gesellschaft.
In Anbetracht dieser Überlegungen wage ich zu sagen, daß Sittenlosigkeit und Korruption skandalöse Ausmaße in der modernen Gesellschaft angenommen haben, weil sich eine gewisse Form der Gleichheit eingeschlichen hat. In jeder Gesellschaft, in jeder Kultur, in jeder Gemeinschaft finden wir Menschen, die durch besondere Tugenden und Vornehmheit hervorstechen. Christliche Werte dürfen in der Gesellschaft nicht verloren gehen.
Papst Pius XII. hinterließ uns zahlreiche Dokumente, vor allem an den römischen Adel gerichtet, in welchen er die traditionellen Tugenden adeliger Familien hervorhob und das Patriziat aufforderte, die Eigenschaften und Tugenden, die eine Familie (oder Person) adeliger Herkunft auszeichnen, zu kultivieren. Er ermahnte die Eliten, ihre angestammten Werte nicht nur beizubehalten sondern sie mit den Lehren Christi zu veredeln.
Aus all diesen Gründen glaube ich, daß dieses Buch von Plinio Corrêa de Oliveira die heutige Gesellschaft auffordert, ihr Gewissen dahingehend zu erforschen, wodurch der echte Adel in der Vergangenheit erkennbar war und sich der wahren Tugenden bewußt zu werden, die zur Bildung einer humaneren und christlichen Gesellschaft beitragen. Echter Adel kennt keine Eitelkeit und keine Selbstsucht. Sein Fundament sind Wahrheit und Güte. Wir sind daher überzeugt, daß dieses Buch ernsthaft zum Nachdenken aufruft und den Menschen wieder die ewig gültigen Werte
des christlichen Glaubens nahe bringt.
Ibarra, 21. Juni 1993
Erzbischof Bernardino Echeverria Ruiz
em. Erzbischof von Guayaquil (am 26.11.1994 zum Kardinal erhoben)
Prinz Luiz von Orleans-Braganza

„Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“ hat exakt den Charakter eines intellektuellen Werkes, das Ereignisse tiefgreifend beeinflussen kann.
Wie die Spitze eines Felsvorsprungs, der von Wellen umspült wird, leidet der Adel seit der Französischen Revolution unter ständigen Angriffen. Fast überall hat er an politischer Macht verloren. Mit Ausnahme der Verwendung von Titel und traditionellen Namen stehen ihm im Allgemeinen keine besonderen Rechte zu. Wirtschaft und Finanz liegen in Händen der Neureichen, die den Kapitalismus auf einen Höhepunkt gebracht haben, und der Jetset prahlt mit seinem Glanz – oder besser gesagt mit seinen glitzernden Pailletten.
Wird der Adel überleben? Hat das Adelsgeschlecht überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Soll er sich einfach auf den Kreis der „Edlen“ beschränken? Oder, wenn der Adel weiter besteht, sollte er dann auch neue, analoge, obwohl nicht identische Eliten einschließen?
Immer wieder sind Mitglieder des Adels zu finden, die sich der Pflichten, die ihr Stand mit sich bringt, bewußt sind. Mit ihrem vorbildlichen Verhalten und ihrer Hilfe für Unterprivilegierte sind sie beispielhaft für andere Klassen. Aber diese Adeligen haben oft bestenfalls nur eine Ahnung von den oben erwähnten Fragen.
Zufällig gibt es ein ähnliches Phänomen bei anderen Klassen, vor allem bei der in der derzeitigen sozialen Struktur am meisten begünstigten Gruppe – der des Bürgertums. Deren wichtigster Rückhalt ist das Recht auf privates Eigentum. Man findet jedoch selten Bürgerliche, die sich bewußt sind, daß dieses Recht auch eine Verpflichtung in moralischer und religiöser Hinsicht mit sich bringt.
Mit der Veröffentlichung des kompletten Textes der Ansprachen Papst Pius XII. an das Patriziat und den Adel von Rom, den erklärenden Kommentaren und historischen Beispielen bringt das Buch von Plinio Corrêa de Oliveira beiden Klassen – Adel und Bürgertum – wichtige Erkenntnisse.
Inspiriert von den Grundsätzen der Lehre des Papstes, lehnt Plinio Corrêa de Oliveira die Denkweise des Klassenkampfes vollkommen ab.
Er betrachtet die Demarkationslinie zwischen dem Adel und dem Volk nicht als Konfliktzone. Ganz im Gegenteil, er zeigt uns den historischen, militärischen und den
Land-Adel als Spitze einer Gesellschaft. Es handelt sich jedoch nicht um einen unbezwingbaren Gipfel sondern um ein Ziel, das man durch Leistung und Verdienste erreichen kann.
Plinio Corrêa de Oliveira sieht die Möglichkeit eines Aufstieges von Mitgliedern des Bürgertums zu einer Elite als Einladung, Verdienste zu erwerben, die ihnen später zur Ehre gereichen. In unserer Zeit, wo die Technik tief in die manuelle Arbeit eingreift und an die Arbeiterklasse Anforderungen auf höchstem Niveau gestellt werden, gibt es viele Möglichkeiten, durch verdienstvolle fachmännische und soziale Leistungen Anerkennung zu finden. Es wäre unfair, dies nicht zu berücksichtigen.
Plinio Corrêa de Oliveira, ein Freund harmonischer und ausgleichender Hierarchie in allen Bereichen des Lebens, bezieht in seiner klaren Interpretation die Grundsätze Papst Pius XII. auf alle sozialen Schichten, ohne sie zu vermischen oder gar zu verwechseln.
Man kann leicht erkennen, daß seine große Sorge vor allem zwei Gegensätzen in der sozialen Hierarchie gilt – dem Adel und den Armen. In brillanten Kommentaren nimmt er hiezu Stellung.
Im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie, der einzigen denkbaren Form der Monarchie heute, sehne ich mich im Grunde meines Herzens nach einer Zukunft, die christlicher Glaube und christliche Kultur auszeichnet. Ideal wäre eine Staatengemeinschaft, die verschiedene Völker, Rassen und Nationen verbindet, die Portugal aufrichtig lieben und portugiesisch sprechen.
Als Oberhaupt des brasilianischen Zweiges des Hauses Braganza und als enthusiastischer und großer Freund portugiesischer Tradition freue ich mich über die Einladung, das Vorwort zu diesem Buch von Plinio Corrêa de Oliveira zu verfassen und kann das Buch allen bestens empfehlen. Ich bin sicher, daß es bei all jenen großen Beifall finden wird, die wissen und fühlen, was echter Adel bedeutet: Ein Mensch zu sein, der den Mitmenschen hilft, immer das zu sein, was Papst Pius XII. empfiehlt – ein wahrer Mensch, erfüllt von Gedanken, die einem Christen zur Ehre gereichen; ein Mensch, der sich nicht einer trägen, leblosen Masse unterwirft, die von einer Diktatur der großen Medienkonzerne manipuliert wird.
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Prinz Luiz von Orleans-Braganza
(Auszug aus dem Vorwort von Prinz Luiz zur portugiesischen Ausgabe des Buches)
Vortrag von Prinzen Luiz von Orleans und Braganza bei der Buchpräsentation in Wien am 30.10.2008
Ew. Exzellenz
Ew. Hoheit usw.
Meine Damen und Herren
Es ist für mich ein großes Privileg, aus Anlass der Vorstellung der deutschen Ausgabe des letzten Buches von Prof. Plinio Corrêa de Oliveira über den Adel und die traditionellen Eliten kurz ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.
Meine Dankbarkeit gegenüber den Organisatoren dieser Veranstaltung ist um so tiefer, als sie mir Gelegenheit bietet, Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, diesem großen Freund meines Vaters, meine bescheidene Huldigung zur Hundertjahrfeier seiner Geburt darzubringen.
Lassen Sie mich an erster Stelle ein paar Worte über den Verfasser des Buches sagen, das heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
1908 in einer aristokratischen Familie geboren, ist er in einer katholisch-monarchistischen Umgebung zu einer Zeit aufgewachsen, in der die Hefepilze der Französischen Revolution, verbunden mit einem wachsenden Einfluss Hollywoods, in der brasilianischen Gesellschaft besonders deutlich spürbar wurden. Der Mythos von Freiheit und Gleichheit führte zu immer vulgäreren Umgangsformen und gleichzeitig schlugen sich immer mehr Menschen auf die Seite des Atheismus und des republikanischen Regimes.
Plinio Corrêa de Oliveira beschloss bereits in jungen Jahren, der katholischen Kirche und ihren monarchischen Grundsätzen die Treue zu halten und sein Leben dem Kampf gegen die ideologischen und religiösen Tendenzen zu widmen, die es darauf abgesehen haben, die christliche Gesellschaftsordnung zu untergraben.
Noch sehr jung übernahm er bereits Führungsaufgaben im katholischen Lager, wurde im Alter von 24 Jahren für die mit seiner Hilfe gebildete katholische Wählerliga mit der größten Stimmenanzahl zum jüngsten Abgeordneten in die verfassunggebenden Versammlung gewählt. Daneben war er Chefredakteur des bedeutendsten katholischen Presseorgans in Brasilien, des „O Legionário“, und Vorsitzender des Diözesanrates der Katholischen Aktion im Erzbistum São Paulo. Später gründete er dann die monatlich erscheinende Kulturzeitschrift „Catolicismo“ und schließlich 1960 die Brasilianische Gesellschaft zur Verteidigung von Tradition, Familie und Privateigentum. Sein in zahlreichen, weltweit verbreiteten Werken dargestelltes Denken regte die Gründung selbständiger analoger Vereinigungen in vielen Ländern an.
Er war von Kindheit an ein Freund meines verstorbenen Vaters, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, mit dem ihn auch eine große ideologische Verwandtschaft verband. So war es nicht mehr als natürlich, dass er sich auch für meine katholische, konterrevolutionäre Fortbildung einsetzte, deren Grundlagen mir bereits im Elternhaus vermittelt worden waren.
Um eines der Themen, das in der Lehre Prof. Plinios für meine weitere geistige und moralische Bildung von grundlegender Bedeutung sein sollte, geht es gerade in dem jetzt auf Deutsch vorliegenden Buch. Sein zentrales Thema ist nämlich die Frage, worin der wahre katholische Adel besteht und welche Rolle diesem im religiösen, politischen und gesellschaftlichen Leben der Völker zukommt.
Als ich Prof. Plinio in den 1950er Jahren kennenlernte, stand die Welt unter dem Zeichen des Mythos der Gleichheit.
Die kommunistische Gleichmacherei herrschte in halb Europa und in der halben Welt und schickte sich an, auch die andere Hälfte in ihre Gewalt zu bringen. In jenen Jahren lag das sowjetische Joch auch auf den Schultern der Österreicher und auch auf den Schultern von einigen hier anwesenden Personen. Zu ihrer Befreiung bedurfte es eines Wunders Unserer Lieben Frau von Fatima, das P. Petrus Pavlicek mit seinem mutigen Rosenkranz-Kreuzzug bewirkt hat.
Und die andere Hälfte Europas und der Welt – was taten sie, um sich von der kommunistischen Gefahr zu befreien?
Ihnen wurde eine versüßte Form des gleichen Egalitarismus listig gepredigt: der „demokratische Sozialismus“.
Tatsächlich wollten auch die Sozialdemokraten damals die Klassen gleichmachen. Zwar nicht auf dem Wege der Enteignung und Diktatur, aber doch durch Einschränkung der Privatinitiative, Umverteilung des Reichtums durch steuerpolitische Maßnahmen und eine anti-elitäre Erziehung, die allen gleiche Chancen versprach. Es handelte sich also um gesellschaftspolitische Programme, die zu einer positiven Diskriminierung der unteren Klassen und zu einer negativen Deskriminierung der sogenannten privilegierten Klassen führten.
Die Sozialdemokratie brüstete sich sogar, ein Schutzwall gegen den Kommunismus zu sein, denn sie gab vor, den unteren Volksschichten mit der schrittweisen Nivellierung der Klassen den Grund zum Aufstand zu nehmen, der angeblich bei der schändlichen sozialen Ungleichheit zu suchen war.
So war schließlich auf beiden Seiten der Berliner Mauer nur noch ein einziges Schlagwort zu hören: Gleichheit, mehr Gleichheit und noch mehr Gleichheit!
In den 70er Jahren musste daher ein namhafter nordamerikanischer Gelehrter feststellen, dass es „deutliche Anzeichen“ dafür gab, dass „in vielen Köpfen die Gleichheit heute wenigstens bei einer großen Anzahl von Philosophem und Sozialwissenschaftlern von einem Nimbus der Heiligkeit umgeben ist und gar dogmatische Züge annimmt“.[1]
In jenen Jahren wagten es nur wenige, die egalitäre Utopie zu kritisieren.
Einige jedoch taten dies unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt und im Namen der individuellen Freiheit und verdienen deshalb unsere Anerkennung. Zu ihnen zählen vor allem zwei große Gestalten der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, Ludwig von Mies und Friedrich von Hayek, die u. a. deutlich machten, dass der Egalitarismus in Wirklichkeit ein „Weg zur Knechtschaft“ ist.
Der viel betrauerte Papst Pius XII. besaß in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Mut, den im Aufschwung befindlichen Mythos des Egalitarismus zu kritisieren.
Den Höhepunkt dieser seiner Lehre finden wir in eben den Ansprachen an das Patriziat und den Adel von Rom, die Prof. Plinio Corrêa de Oliveira so meisterhaft in diesem Buch kommentiert.
In diesen Ansprachen zeigt Pius XII., dass Gott selbst der Urheber der gesellschaftlichen Ungleichheit ist, da er die Menschen mit unterschiedlichen Begabungen geschaffen hat und sie in Familien auf die Welt kommen lässt, die diese Eigenschaften auf Grund der geheimnisvollen Gesetze der Vererbung von Generation zu Generation weitergeben. Der Papst Pacelli hat dies poetisch so ausgedrückt: „Der Segen Gottes erleuchtet, schützt und liebkost alle Wiegen, ohne sie jedoch gleichzumachen“.[2]
Wer dem Egalitarismus das Wort redet, begehrt demnach gegen den Plan gesellschaftlicher Harmonie auf, den Gott für den Fortschritt und das Glück der Menschen auf Erden entworfenen hat.
Es war großer Mut nötig, um so etwas 1950 auszusprechen. Aber es war gerade dieser Mut, „politisch unkorrekte Positionen“ zu behaupten, die Eugenio Pacelli einerseits so viel Bewunderung eingebracht haben und andererseits so viel Hass und Verleumdungen, die bis heute hin und wieder in Umlauf begracht werden.
Nach dem Aufsehen erregenden Zusammenbruch des „realen Sozialismus“ ist es heute viel leichter, den Egalitarismus – wenigstens in seinen radikalen Formen – zu kritisieren als vor 50 Jahren.
„Was ist eine Elite?“, fragt Dr. Plínio. Eine Elite ist eine Gruppe von Menschen, die sich durch ihre besonderen Eigenschaften von der Menge der Mitglieder einer Gemeinschaft abheben? Eine Elite setzt sich jedoch nicht aus isolierten Individuen zusammen, die keinen Bezug zu einander haben, denn es handelt sich eben nicht um eine einfache Aneinanderreihung hervorragender Menschen.
Eine Elite entsteht, wenn hervorragende Menschen sich untereinander austauschen und sich gegenseitig qualitativ dermaßen bereichern, dass sie nach und nach eine eigene Kultur schaffen, die die geistigen und moralischen Werte ihrer Mitglieder zusammenfasst und erhebt.
Dieser Destillationsvorgang ist vor allem Folge einer scheinbar belanglosen, in Wirklichkeit jedoch sehr ernsten Erscheinung, die man gesellschaftliches Leben nennt.
Zum Beispiel:
In der entspannten Atmosphäre einer Soiree kommen sowohl der große Diplomat und der geschickte Finanzmann miteinander ins Gespräch als auch der inspirierte Schriftsteller und der praktische Ingenieur, der wortreiche Rechtsanwalt und der umsichtige Arzt, und vor allem unterhalten sich auch diese alle mit vielen Damen, die einerseits der ätherischen Welt der Kunst, der Gefühle und der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie andererseits der Welt der Familie zugewandt sind.
Der gegenseitige Austausch von Gedanken und Werten, der durch den gesellschaftlichen Kontakt gefördert wird, lässt diesen Gesellschaftskörper eine besondere Art des Denkens und Fühlens destillieren, die ihn nach und nach verfeinern.
Wenn Prof. Plinio von Elite spricht, hat er nicht allein die hohe Elite der Hauptstadt im Auge, wie etwa die Elite von Wien. Unterhalb dieser nationalen Elite bilden sich kleinere Eliten, in deren Schoß sich das gleiche Spiel gegenseitiger Beziehungen wiederholt, bis hinab zur örtlichen Dorfelite, die sich um den Pfarrer oder um den Dorfwirt herum bildet.
So entsteht eine Elitenhierarchie, die, ausgehend von den örtlichen Eliten, in immer ausgewähltere Kreise aufsteigt, bis sie schließlich die wesentlichsten Eliten erreicht. Diese durchgehende Treppe bildet mit ihren Stufen die Struktur einer gesunden Elitegesellschaft, in deren höchsten Kreisen sich Lebenstile und Menschentypen entwickeln, die auf harmonische Weise die darunter liegenden Ebenen beeinflussen.
Eine Gesellschaft harmonischer Eliten setzt also zwei fortlaufende Bewegungen voraus, eine vertikale und eine horizontale.
Die vertikale Bewegung erlaubt den Aufstieg wirklich verdienstvoller Menschen, während die horizontale Bewegung die gegenseitige Ergänzung von Menschen auf der gleichen Ebene ermöglicht und den gemeinsam begangenen Weg zur Vollkommenheit fördert.
Es ist ein Kennzeichen lebendiger und gesunder Wesen, sich fortwährend auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit hin zu bewegen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Eltern, seien sie nun Arbeiter, Bürger oder Aristokraten, ihrer Nachkommenschaft wenigstens dasselbe Lebensniveau wie ihr eigenes weitergeben wollen. In diesem Sinne wird eine Gesellschaftsklasse von einer Gruppe von Familien gebildet, die eine bestimmte Perfektionsniveau erreicht haben.
Das Streben nach Kontinuität ist an sich richtig, es ist aber nicht ausreichend. Denn die Eltern sollten für ihre Kinder nach Möglichkeit bessere Verhältnisse anstreben, sei es im Sinne der horizontalen Bewegung derer, die in den gleichen gesellschaftlichen Verhältnissen verbleiben, oder sei es in Ausnahmefällen bei vertikaler Bewegung durch den Aufstieg in höhere Verhältnisse.
Die Mitglieder der höheren Klassen dürfen ihrerseits nicht jene als subversive Elemente, die es wegen ihrer Begabung und ihrem Lebensstil verdienen, in ihre gesellschaftliche Umgebung aufgenommen zu werden, denn es handelt sich ja nicht um Revolutionsführer, sondern um Menschen, die zum allgemeinen Fortschritt beitragen.
Diese doppelte Bewegung ereignet sich mit bemerkenswerter Viefalt in Ländern, die von echtem Christentum beseelt sind und in denen die Tugend der Nächstenliebe übernatürlicher Prägung eine unvergleichliche Wirkung ausübt. Geschichtlich gesehen ist es diese Art von Elitegesellschaft, die sich im Abendland nach den Vorgaben der christlichen Zivilisation herausgebildet hat und von der wir ausdrucksvolle Beispiele in dem patriarchalischen Stil haben, der das Österreich und Wien früherer Zeiten gekennzeichnet hat.
Der Begriff Elite wird gewöhnlich von allerlei Eigenschaftswörtern begleitet, wie etwa politische Elite, berufliche Elite, kulturelle Elite usw. Diese Eigenschaftswörter bringen einen Aspekt der authentischen Elite zum Ausdruck, der die Menschen auszeichnet, aus denen sie sich jeweils zusammensetzt.
Es sind zwei Eigenschaftswörter, die den Inhalt des Begriffs am besten wiedergeben: traditionelle Elite und aristokratische Elite.
Eine traditionelle Elite, und wenn sie auch nur aus den kleinen örtlichen Notabeln eines Dörfchens in Tirol besteht, gewährleistet am besten die Übertragung der gemeinsamen, von dieser gesellschaftlichen Gruppe destillierten Werte von einer Generation auf die nächste.
Von einer aristokratischen Elite als dem höchsten Ausdruck traditioneller Eliten sprechen wir, wenn ihre kulturellen Werte derart verfeinert sind, dass sie den nachstehenden gesellschaftlichen Eliten als Vorbild dienen, und wenn sie in ihrem Tun und Lebensstil mehr dem Dienst und dem Gemeinwohl als dem eigenen Nutzen zugewandt sind. Dieser Wesenszug macht den Unterschied des wahren Adels aus.
Die traditionellen Eliten, egal ob sie aus dem Volke, dem Bürgertum oder aus der Aristokratie hervorgegangen sind, bilden nur in dem Maße eine authentische Elite, in dem Vortrefflichkeit ihr Tun und ihren Lebensstil auszeichnet und in dem ihre Mitglieder dem Leitbild der jeweiligen Gesellschaftsgruppe treu bleiben.
Das bedeutet aber auch, dass eine bestimmte Gruppe zwar ein bedeutendes Vermögen und einen großen Machtanteil besitzen kann, und doch keine wahre Elite bildet, wenn sie nicht jenen eigenen Vortrefflichkeitsstandard entwickelt, der die authentischen Eliten auszeichnet, denn in diesem Fall fehlen ihr die den echten Eliten eigenen Horizonte, ihr Stil, ihre Sitten und ihr Takt.
Der Inbegriff aller nicht authentischen Eliten ist der Jetset. Er wird von der Regenbogenpresse wie Milliardäre, Filmstars und Sportler umschwirrt. Um diesem Jetset anzugehören braucht man nur Geld, den Wunsch, es für exzentrische Dinge auszugeben, und den Drang zur Öffentlichkeit.
Tatsächlich besitzt jede Stadt, jede Region, jedes Land eine kollektive Persönlichkeit, eine „gemeiname Seele“, die das kollektive Ergebnis ihrer Weiterentwicklung und eine Synthese der von den einzelnen Menschen, den Familien und den Klassen angestrebten Perfektionen ist.
Der wahre Aristokrat zeichnet sich dadurch aus, dass er diese „gemeinsame Seele“ zum Ausdruck bringt. Er erhebt sich auf eine Ebene, die über seiner Gemeinschaft liegt, und personifiziert sie. Deshalb kommt ihm die Rolle zu, die „gemeinsame Seele“ darzustellen, sie zu bewahren und ihr weiterzuhelfen.
Der wahren Elite und wahren Aristokratie geht es letztlich darum, ernsthaft und mit Eifer das Vorbild der Vollkommenheit zu verwirklichen, das unser Herr Jesus Christus vorgelebt hat, und es mit dem Wesen des eigenen Volkes in Einklang zu bringen.
Die Tugenden, die das sittliche Bild eines christlichen Aristokraten ausmachen, nämlich Selbstlosigkeit, Tapferkeit, Großmut, Achtung vor den Geringeren, leiten sich vom Beispiel und von der Lehre des menschgwordenen Wortes ab, das diese selbst in höchstem, ja unendlichen Grade besitzt.
Es ist daher möglich, dass es Heilige gibt, deren Tugenden nicht von den Eigenschaften geprägt sind, die einen Aristokraten auszeichnen. Der vollendete Aristokrat aber, der die Tugenden des Adels in seinem Leben auf heroische Weise verwirklicht, ist auch stets ein Heiliger oder doch wenigstens auf dem Weg, ein solcher zu werden.
Das Österreichische Volk kann in den Annalen seiner Geschichte mehrere Beispiele von heiligen Aristokraten anführen. Wie zum Beispiel der hl. Leopold III.
Wenn heute die Gesellschaftsordnung aus den Fugen gerät und wir vielleicht die größte religiöse und moralische Krise erleben, in die die Menschheit je gestürzt wurde, bedarf die Welt mehr denn je dieser authentischen Eliten, die nach Heiligkeit streben.
Das ist auch der Kern der Botschaft, die Plinio Corrêa de Oliveira uns in diesem seinem letzten Meisterwerk hinterlassen wollte, das auf den kostbaren Lehren fußt, die Papst Pius XII. an das Patriziat und den Adel von Rom gerichtet hat.
Ein jeder von uns sollte versuchen, diesen Aufruf in seinem persönlichen Wirkungsbereich umzusetzen und Sorge dafür zu tragen, dass aus der Asche der modernen Welt eine neue christliche Zivilisation hervorgehe, so wie aus den Trümmern des Römischen Reiches der Glanz des Mittelalters heraufzog.
Möge Unsere Liebe Frau uns Licht und Kraft schenken, damit wir dieser historischen Sendung gerecht werden können.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
[1] Richard Nisbet, “The Pursuit of Equality“, The Public Interest 35 (1974), 103, zitiert in Antony Flew, Politics of Procrustes, S. 2.
[2] Ansprache an das Patriziat und den Adel von Rom, 1942.
Vortrag von Herzog paul von Oldenburg bei der Buchpräsentation in Wien am 30.10.2008

Die Notwendigkeit von Eliten zur Erneuerung der Christenheit.
Paul Herzog von Oldenburg, Wien 30.10.2008
Einleitung:
Dieses Thema ist eigentlich zu weit und groß, als daß es innerhalb von 20 Minuten abgehandelt werden könnte. Für eine umfassende und erschöpfende Analyse empfehle ich daher die tatsächliche Lektüre des Buches, das wir Ihnen heute vorstellen. „Der Adel und die vergleichbaren Eliten in den Ansprachen Papst Pius XII. An den Adel und das Patriziat von Rom“.
Ich werde dennoch den Versuch unternehmen zumindest auf einiges einzugehen, was mir persönlich am wichtigsten erscheint.
Lassen Sie mich konzentrieren auf drei wesentliche Punkte: die Beschreibung der Krise, in der die Christenheit sich befindet; auf die Erneuerung, die Re-Christianisierung der Gesellschaft, ja ganzer Nationen, denn dies ist der einzige Weg, sie vor dem Untergang zu retten, und als Drittes auf die Möglichkeiten und die Pflichten, die dem Adel und den traditionellen Eliten dabei zukommen.
Die Krise
Wir erleben im Moment einen Zusammenbruch. Die Bankenkrise stellt die Frage nach der Vorherrschaft in der Welt neu. Schlagzeilen wie „Die Herausforderungen der neuen Weltordnung“, oder „Krieg um Wohlstand“ oder „Is anyone in charge of todays nonpolar world?“ – Ist irgendjemand zuständig für die heutige führungslose Welt? Führen uns vor Augen, daß wir an einer Zeitenwende stehen könnten. Die USA, da sind sich alle einig, werden wohl ihre Führungsrolle in der Welt einbüßen, aber wer wird sie übernehmen?
Der europäische Einigungsprozess stockt. In den einzelnen Ländern wenden sich die Menschen immer weiter ab von den etablierten Parteien, die Politik ist nicht imstande, den Menschen Antworten zu geben, geschweige denn, Vertrauen aufzubauen. Irrationalismus macht sich breit – in Deutschland erkennbar am Zulauf zu den Postkommunisten – man sehnt sich nach dem starken Staat, einer starken Führung, die sich für einen einsetzt und die Probleme löst.
Die einst so strahlende Christenheit, geboren im Nahen Osten und zur Hochblüte hier in Europa gelangt und ausgebreitet über alle Kontinente, wendet den christlichen Prinzipien immer weiter den Rücken zu.
Aus der Kirche hört man vereinzelt den Protest hochrangiger Prälaten, mal leiser, mal lauter doch scheinbar wirkungslos.
Doch was auf die katholische Kirche erst noch zukommt – und damit natürlich auch auf uns – zeigt die Entschließung des Europarates vom 29. Juni 2007, in der ganz klar formuliert wird, daß für eine zukünftige Ordnung in Europa nur noch die Charta der Menschenrechte bindend sein kann, die die Grundlage bilden soll für die neue europäische Verfassung. Es heißt dort weiter, daß die Religion Privatsache zu sein hat, eine Einmischung in den Meinungsbildungsprozeß darf es nicht mehr geben. Alle in der Gesellschaft aktiven Institutionen haben die Menschenrechte anzuerkennen, eine gegenteilige Position, wie sie die Kirche in einigen Bereichen prinzipiell beziehen muss, muss mit allen Mitteln unterbunden werden.
Die Menschenrechte werden das höchste Dogma sein. Dieses Dogma erlaubt keine Infragestellung, keinen Protest. Der Platz, den Gott in der katholischen Gesellschaft des Mittelalters einnahm, – wo jede Verletzung der Rechte Gottes inakzeptabel war – wird nun durch die Menschenrechte besetzt. Manche sehen am Horizont eine neue Christenverfolgung mitten in Europa heraufziehen.
Die moralische Verwüstung, die immer noch und immer mehr von allen Medien, der Musikindustrie und durch das Internet gefördert wird, hat gravierende Ausmaße erreicht. Daraus resultiert auch die Kinderfeindlichkeit unserer Gesellschaft, die die europäische, sagen wir einmal, Ur-Bevölkerung zusammenschrumpfen läßt.
Sie werden mir zustimmen, daß wir wirklich in einer Krise stecken. Es ist die Krise der Christenheit. Und sie ist eine weltweite Krise.
In dem Maße, in dem über die Jahrzehnte die christlichen Werte und Prinzipien zurückgedrängt wurden, in dem Maße, wie sich alle Organismen der Gesellschaft immer mehr von Gott entfernt haben, in dem Maße nehmen die atheistischen, die freidenkerischen Programme, in dem Maße machen sich Hochmut, Sinnlichkeit, Rohheit, Verdorbenheit, Häßlichkeit, Banalität, Profanität breit. Der Widersacher nimmt den freigewordenen Platz ein. Das Gegenteil der Tugenden wird gelebt, denn Gott gibt es nicht, Gott ist deshalb kein Maßstab mehr.
Doch damit, dies lehrt uns die Geschichte, wäre das Ende dieser Gesellschaft eingeläutet. Und dies lehrt uns ebenfalls die Botschaft von Fatima, in der, für den Fall einer fehlenden Bekehrung der Menschen und Nationen, Strafen angekündigt werden.
Jetzt hat sogar Papst Benedikt XVI. in einer beeindruckenden Predigt vor der Bischofssynode diese möglichen Strafen genau in diesem Zusammenhang zur Sprache gebracht. Es geht um den Sohn des Weinbergbesitzers, der von den Winzern ermordet wird, da diese hoffen, damit in den Besitz des Bergs zu kommen.
Zitat:
„Was in diesem Abschnitt aus dem Evangelium beklagt wird, stellt unsere Art zu denken und zu handeln in Frage; es stellt vor allem eine Anfrage dar an die Völker, denen das Evangelium verkündet worden ist. Wenn wir die Geschichte betrachten, so werden wir nicht selten die Kälte und den Widerstand inkonsequenter Christen feststellen müssen. Infolgedessen mußte Gott, ohne jemals sein Heilsversprechen zurückzunehmen, oft auf Züchtigungen zurückgreifen. Unwillkürlich denkt man in diesem Zusammenhang an die erste Verkündigung des Evangeliums, aus der anfänglich blühende christliche Gemeinden hervorgingen, die dann verschwanden und heute nur in den Geschichtsbüchern Erwähnung finden. Könnte das nicht auch in unserem Zeitalter geschehen? Nationen, die einst reich an Glauben und Berufungen waren, verlieren mittlerweile unter dem Einfluß einer verderblichen und zerstörerischen modernen Kultur zunehmend ihre Identität. Es gibt Menschen, die beschlossen haben, daß »Gott tot ist«, und sich selbst zu »Gott« erklären und glauben, die einzigen Schöpfer ihres Schicksals und die Herren der Welt zu sein.“
Weiter unten fleht er sogar die Synodenväter an: „Es darf nie geschehen, liebe Brüder und Schwestern, was in der Bibel über den Weinberg gesagt wird: Er hoffte, daß der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren“(vgl. Jes 5,2).
Doch offensichtlich sind heute „die sauren Beeren“ in der großen Überzahl.
Wir brauchen also eine Erneuerung des Glaubens.
Die Erneuerung
Wir brauchen also eine neue Durchdringung der gesamten Gesellschaft mit den Werten und Prinzipien, auf denen unsere Zivilisation aufgebaut wurde. Wir brauchen eine Re-Christianisierung Europas.
Lassen Sie mich aus der großartigen Enzyklika „Immortale Dei“ von Papst Leo XIII. zitieren, der uns erinnert, wie das Ziel der Re-Christianisierung auszusehen hat.
„Es gab eine Zeit, in der die Philosophie des Evangeliums die Staaten regierte. In dieser Epoche durchdrangen der Einfluß der christlichen Weisheit und ihre göttliche Kraft die Gesetze, die Einrichtungen, die Sitten der Völker, alle Kategorien und Beziehungen der bürgerlichen Gesellschaft. Dank der Gunst der Fürsten und des legitimen Schutzes der Amtspersonen blühte damals überall die von Christus gegründete Religion und erhielt die ihr zustehende Anerkennung. Zwischen Priestertum und Kaisertum herrschte ein glückliches Einvernehmen im Dienste freundschaftlicher Gegenseitigkeit. Auf diese Weise organisiert trug die bürgerliche Gesellschaft unerwartet reiche Früchte und die Erinnerung an sie lebt fort und wird in den zahllosen Zeugnissen weiterleben, die kein Manöver ihrer Gegner jemals verderben oder verdunkeln kann.“
Der Papst spricht hier vom Mittelalter. Und das muß unser Maßstab sein. Eine Gesellschaft durchdrungen von den christlichen Werten und göttlichen Tugenden.
„Utopie!“ – wird man mir nun entgegen schleudern. „Das wird es nie mehr geben“ oder „Diese Zeit ist unwiederbringlich vorbei.“
Ja natürlich. Das Mittelalter wird es nie wieder geben. Wir leben heute und heute sind die Voraussetzungen andere. Es geht aber auch nicht um das Zurückdrehen der Zeit. Sondern es geht um die Essenz, das Grundsätzliche.
Die Wiederherstellung einer Gesellschaft, die Gott wieder in den Mittelpunkt setzt, Ihn als den alleinigen Maßstab aller Dinge und Handlungen anerkennt, verehrt und preist. Das ist das Ziel.
Was ist dabei aber die Rolle der Eltien?
Die Notwendigkeit der Eliten
Fragen wir uns erst einmal, wer denn die von Papst Leo XIII. beschriebene Gesellschaft aufgebaut hat, wer hat denn diese Staaten geleitet, wer hat zugunsten des Gemeinwohls darauf geachtet, daß diese enge Verbindung von Kirche und Staat, diese gegenseitige Befruchtung stattfinden konnte, wer hat sich immer dann schützend vor die Kirche gestellt, wenn sie angegriffen wurde, wer hat die freie Verkündigung des Evangeliums durch die Missionare sichergestellt, wer hat dadurch ganze Völker erhoben, wer hat dadurch die so reichen kulturellen Schätze in Architektur, Kunst und Musik hervorgebracht, vor denen wir uns noch heute staunend verneigen?
Es sind natürlich die traditionellen Eliten gewesen. Und unter ihnen der Adel insbesondere. Und damit sind es auch Ihre Familien gewesen. Es sind die traditionellen Eliten gewesen, die in der weltlichen Ordnung die Verantwortung für das Gemeinwohl übernommen haben. Die Eliten also, eine kleine Gruppe von Menschen, die fast anderthalb Jahrtausende von der Spitze her geführt hat.
Papst Pius XII. lehrt uns nun in seinen Ansprachen an den Adel und das Patriziat von Rom, daß diese Eliten diese Verantwortung immer noch haben, auch heute, da wir in Demokratien leben und unsere Familien, mit wenigen Ausnahmen, keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden.
Dies betont auch rückblickend Papst Paul VI in einer Ansprache an das Patriziat und den Adel von Rom 1964 in einem Rückblick:
„So viel möchten wir euch sagen. Eure Gegenwart löst so viele Überlegungen aus. So erging es auch unseren verehrten Vorgängern – vor allem Papst Pius XII. seligen Angedenkens –, die sich bei Gelegenheiten wie dieser mit mustergültigen Reden an euch gewandt und euch eingeladen haben, im Lichte ihrer bewundernswerten Lehren sowohl über die Umstände eurer eigenen Lage als auch über die unserer Zeit nachzudenken. Wir nehmen an, daß das Echo ihrer Worte wie der Wind, der die Segel bläht, …. noch heute euer Gemüt bewegt und es mit jenen strengen, großzügigen Mahnrufen erfüllt, von denen sich die Berufung nährt, die euch die Vorsehung für euer Leben gezeigt hat, und auf die sich der auch heute noch von der Gesellschaft geforderte Auftrag stützt, der euch angeht.“[1]
Ich möchte an dieser Stelle nicht so sehr auf die Rechtfertigung der Eliten eingehen, die in aller Ausführlichkeit im Buch nachzulesen ist.
Stattdessen lassen Sie mich eingehen auf die höchste soziale Funktion des Adels, wie Pius XII. herausstellt. Sie ist „die Wahrung, Verteidigung und Verbreitung der christlichen Lehre, die in den ihn auszeichnenden Traditionen enthalten ist.“
Dazu sei es absolut notwendig, daß insbesondere der Adel sich hüten muß vor dem moralischen Verfall, der so sehr um sich greift, so Pius XII.
„Was Euch betrifft, sorgt dafür und seid wachsam, damit schädliche Theorien und perverse Beispiele niemals mit Eurer Zustimmung oder Sympathie rechnen können und vor allem in Euch keine willigen Träger oder die Gelegenheit, Infektionsherde zu bilden, finden.“
Diese Pflicht ist Bestandteil des „großen Respekts vor den Traditionen, die Ihr besitzt und durch den Ihr Euch in der Gesellschaft auszeichnet“. Diese Traditionen bilden einen „wertvollen Schatz“, den der Adel „mitten unter dem Volke“zu wahren hat.
„Möglicherweise ist das heutigentags die wichtigste, soziale Funktion des Adels; sicherlich ist es der größte Dienst, den Ihr der Kirche und dem Vaterland erweisen könnt“.
Das ist also die erste Aufgabe des Adels: Sich nicht dem Zeitgeist anpassen.
Prof. Correa de Oliveira kommentiert diese Sätze: „Der Adel kann den Glanz vergangener Jahrhunderte, der noch heute von ihm ausgeht, kaum besser verwenden als die in den ihn auszeichnenden Traditionen enthaltene christlichen Lehre zu wahren, zu verteidigen und zu verbreiten.“
Ein schwieriges Unterfangen, wo wir doch alle nur Menschen sind und so anfällig gegenüber einem Aussenseitertum, was eine Zurückweisung des Zeitgeistes heute natürlich bedeuten würde..
Doch der Papst ist der Ansicht, daß dies möglicherweise der größte Dienst sei, den wir der Kirche und dem Vaterland erweisen könnten. Er bekräftigt dies am Abschluß seiner Ansprache von 1958 mit den Worten: „Damit der Allmächtige Eure Absichten bestärke und Unsere Gebete erhöre, die Wir darum an Ihn gerichtet haben, möge auf Euch allen, auf Euren Familien und besonders auf Euren Kindern, die Eure beste Tradition in die Zukunft tragen, Unser Apostolischer Segen ruhen.“
Johannes XXIII. mahnt 1960, daß der Adel, dem viel gegeben ist, auch viel zu leisten hat, insbesondere im Hinblick auf ein tugendhaftes Leben. Er wird in besonderem Maße Gott gegenüber darüber Rechenschaft abzulegen haben.
Doch reicht das? Einfach ein tugendhaftes Leben führen und ansonsten sich in der wohligen Anonymität bewegen, in die die meisten sich zurückgezogen haben?
Nein, sie dürfen sich nicht aus dem konkreten, d.h. öffentlichen Leben zurückziehen. Aus dem einfachen Grunde, da die Wahrung der Tradition, die dem Adel und den traditionellen Eliten zukommt, die Gesellschaften vor dem Stillstand bewahrt. Denn die wahre Tradition ist zukunftszugewandt und fortschrittlich. Sie garantiert eine harmonische Weiterentwicklung. Das wahre Traditionsbewußtsein bewahrt die Gesellschaft vor plötzlichen Sprüngen, vor Brüchen, die gefährliche Auswirkungen haben könnten. Dies zu verhindern ist Aufgabe des Adels und der traditionellen Eliten. Wenn er sich aber aus der Öffentlichkeit zurückzieht, kann er diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen.
Pius XII.: „Ihr laßt Eure Vorfahren neu aufleben, indem Ihr sie ins Gedächtnis zurückruft. Und Eure Ahnen leben wieder auf in Euren Namen und in den Euch hinterlassenen Titeln, den Zeugen ihrer Verdienste und Wohltaten.“
„Jeder Mensch hat seine Bestimmung, jeder muß dem Fortschritt der Gemeinschaft dienen, deren Verbesserung er mit seinen ganzen Kräften und eigenen Talenten zu dienen hat. So muß es sein, wenn jeder wirklich seinen Nächsten liebt und vernünftigerweise das allgemeine Wohl anstrebt.“
Und der große Papst vergleicht den Adel mit dem Regler an einer Maschine, der dafür sorgt, daß das Ganze richtig und zweckentsprechend funktioniert. „Mit anderen Worten, so Pius XII., Ihr seid die Tradition und setzt sie fort. „
Noch deutlicher an anderer Stelle: „Heute, mehr wie je zuvor, seid ihr berufen, eine Elite zu sein, nicht nur durch das Blut und Abstammung, sondern mehr noch auf Grund Eurer Werke und Eures Einsatzes, der schöpferischen Handlungen zum Wohle der ganzen menschlichen Gemeinschaft. Dieser Verpflichtung kann sich niemand ungestraft entziehen. Sie ist nicht nur eine menschliche und staatsbürgerliche Pflicht, sondern ein heiliges Glaubensgebot, ererbt von Euren Vätern und das Ihr, wie sie, vollständig und ungeschmälert, an Eure Nachfahren weiterzugeben habt.“
Der Papst spricht von einen heiligem Glaubensgebot. Es ist ein heiliges Glaubensgebot des Adels und der traditionellen Eliten, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.
Aber natürlich entsteht dann die Frage nach dem WIE. Wie können denn der Adel und die traditionellen Eliten etwas bewirken?
Hier sind einige anwesend, von denen ich weiß, wie sehr sie sich im Sinne von Papst Pius XII. vorbildlich engagieren durch hervorragenden Einsatz im caritativen Bereich, Aufbau von Glaubenserneuerungsgruppen, Aufbau von wirklich katholischen Kindergärten und Schulen, Unterstützung von wirklich katholischen Priesterseminaren usw. . Doch die Führungsrolle in der Gesellschaft schlechthin, die Pius XII. dem Adel auch noch heute zuspricht, haben andere.
Wie sieht aber diese Führungsrolle heute aus?
Dadurch, daß dem adeligen bestimmte Qualitäten zu eigen sind, so der Papst, ist der zum Führer der Gesellschaft bestimmt. Diese Eigenschaften sind seelische Stärke, Einsatzbereitschaft, freudiger Mut, der eine Ohne-mich- Einstellung nicht zuläßt, großmütiger Einsatz, Geistesstärke, die nicht zuläßt, sich aufzugeben und zu fliehen, Tatbereitschaft, Opferbereitschaft für das Gemeinwohl, Hingabe für andere. Die die reichhaltigere Mittel besitzen, nicht materiell sondern hier Gaben des Verstandes, der Kultur, der Erziehung , der Wissens, des Einflusses, müssen diese auch einsetzen für das Ganze. Ritterlichkeit .
Es gibt vielfältige Organisationen, die sich den brennenden Herausforderungen der Zeit zugewandt haben, sei es zum Thema Abtreibung, zur „Homoehe“, zur Euthanasie, zu Fragen der Genmanipulation, des Klonens usw. Dort z.B. müßten die bekannten Namen erscheinen. Dort müssten in großem Maße Vertreter des Adels ihre Stimme erheben, denn bei diesen Themen handelt es sich um die vom Heiligen Vater so genannten nicht verhandelbaren Prinzipien, Prinzipien, die den Kern der christlichen Kultur ausmachen und an denen keiner rühren darf, sei er auch noch so demokratisch legitimiert.
Papst Pius XII. sagt weiter wörtlich: „In all dem, was Dienst ist für den Nächsten, für die Gesellschaft, für die Kirche und für Gott, müßt Ihr immer die ersten sein.“
Und damit verlangt vom Adel die Führung der Gesellschaft, insbesondere heute, da wir feststellen, daß aus dem Volk eine namenlose, leicht manipulierbare Masse geworden ist, die „zum Spielzeug der Leidenschaften oder Interessen ihrer Aufwiegler sowie der eigenen Illusion geworden ist. Hat die Geschichte vielleicht nicht schon grausam bewiesen, daß jede menschliche Gesellschaft, ohne religiöse Grundlage unweigerlich ihrer Auflösung entgegengeht oder im Terror endet? Euren Ahnen nacheifernd, müsst Ihr also vor dem Volk leuchten durch das Licht Eures Frömmigkeitslebens, durch den Glanz Euer unerschütterlichen Treue zu Christus und der Kirche.“
Und es folgt ein leidenschaftlicher Aufruf zur Rettung der Familie und die Ermahnung zur Unerschütterlichkeit in der Überzeugung, daß einzig die Lehre der Kirche den gegenwärtigen Übeln wirksam abhelfen kann. Daraus folgt, daß der Adel alles daran setzen muß, der Kirche den Weg freizumachen, damit sie die Lehre verkünden kann.
Spätestens hier müssen wir uns fragen: Stehen wir vor dem Volk? Geht von uns das Leuchten eines Frömmigkeitslebens aus? Sind wir wie Leuchttürme der Orientierung für unsere Völker, so wie der Heilige Vater es von uns verlangt? Verteidigen wir die Kirche gegen die Angriffe, denen sie immer häufiger ausgesetzt ist, in der Weise, daß sich auch andere ermutigt sehen, das gleiche zu tun? Gehen wir aktiv und öffentlich vernehmbar gegen demokratisch legitimierte Politik vor, die offen der Lehre der Kirche widerspricht?
Diese Fragen kann sich jeder selbst beantworten. Doch wir müssen sie beantworten, in dem wir unserem Herrn dabei in die Augen schauen, der selbst, zwar in bescheiden Verhältnissen aufgewachsen, dennoch aus dem königlichen Hause David stammt. Er, und das mußte auch ich erst lernen, will unseren Einsatz, auch wenn unserer Väter uns vielleicht resigniert bedeuten, daß unsere Zeit vorbei sei.
Wir sollen und müssen uns wieder allen in der Gesellschaft zuwenden, wir kennen unsere Wurzeln und in aller Demut müssen wir die Bürde auf uns nehmen und den Kampf austragen gegen die Feinde der Kirche, gegen die Feinde der Christlichen Sitten und Kultur, gegen die Feinde der christlichen Zivilisation. Wir müssen kämpfen für eine Gesellschaft, die den wahren Eckstein annimmt und auf ihm aufbaut.
Dieses Buch hat den Anspruch, diese Verpflichtung dem Adel und den traditionellen Eliten wieder nahe zu bringen und sie anzuspornen, sie auch bereitwillig zu übernehmen, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich gegen den Zeitgeist für das Gemeinwohl einzusetzen. Das Volk kann sich nur durch die Annahme und das Leben der christlichen Tugenden und die Beachtung der katholischen Lehre zu einer wahren Zivilisation, zu einer christlichen Zivilisation entwickeln.
Laufen wir nicht weg von dieser Aufgabe.
Danke für Ihre Aufmerkamkeit.
[1] Ansprache an das Patriziat und den Adel von Rom, 1964, S. 73.
Vortrag von Baron Prof. Roberto de Mattei bei der Buchpräsentation in Wien am 30.10.2008
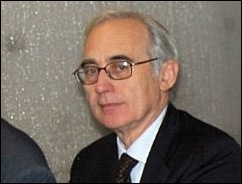
Vom Ende einer Welt der Sicherheit ins Zeitalter des Chaos
Wir nähern uns dem hundertsten Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges. Bald werden es hundert Jahre her sein, dass an jenem 28. Juni 1914 die Revolverschüsse von Sarajevo des Ende einer Epoche ankündigten. Heute wird es immer deutlicher, dass der Erste Weltkrieg in der europäischen Geschichte einen keineswegs geringeren Bruch darstellt als die Französische Revolution, denn auch in diesem Fall handelte es sich um eine Revolution.
Talleyrand hat einmal beheuptet, dass einer, der nicht schon vor 1789 gelebt hat, nicht weiß, was Lebenfreude ist. Heute können wir ähnlich behaupten, dass einer, der nicht vor 1914 gelebt hat, nicht weiß, was eine Welt der Sicherheit bedeutet.
Vielleicht sollte man sich noch einmal die Seiten des Buches Die Welt von Gestern (1941) von Stefan Zweig (1881-1942) zu Gemüte führen. In diesem Buch schreibt Zweig, dass sich die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg am besten mit dem Begriff „goldenes Zeitalter der Sicherheit“ umschreiben lässt. In der fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien es, als sei alles auf Dauer angelegt, und selbst der Staat habe einen Eindruck unerschütterlicher Festigkeit verbreitet. Niemand habe geglaubt, es könnte Krieg, Revolution oder Umsturz geben. Im Zeitalter der Vernunft musste jedes radikale, gewaltsame Vorgehen als ein Ding der Unmöglichkeit erscheinen.[1]
Der fortschreitende Verlust der Sicherheit durchzieht wie ein roter Faden des 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert der Kriege und Revolutionen, wenngleich die großen Totalitarismen noch halbwegs eine Illusion von Sicherheit anzubieten vermochten. Heute haben der Fall der Mauer und der Einsturz der Twin Towers das Gefühl der Sicherheit in der westlichen Welt endgültig erschüttert, denn es war ein Gefühl, das sich auf die Festigkeit der beiden sich gegenüberstehenden Supermächte Russland und Amerika stützte.
Das Zeitalter der Unsicherheit, in dem wir heute leben, ist das Zeitalter des Chaos auf allen Ebenen. Es sind auch bereits Bücher erschienen, die den bedeutsamen Titel Geopolitik des Chaos tragen.[2] Die Geopolitik des Chaos bezieht das kulturelle und moralische Chaos, das aus dem Relativismus und der Identitätskrise unserer Zeit hervorgegangen ist, auf eine Ebene, die die nun ganze Welt umfasst. Und zum allgemeinen politischen Chaos gesellt sich das noch schwerwiegendere wirtschaftliche Chaos. Die Säulen der Wirtschaft wanken und unser tägliches Leben sieht sich selbst in seinen materiellsten Aspekten bedroht.
Diese Identitätskrise macht vor keinem Wert und keiner Institution halt, weder vor der Familie noch vor der Nation, ja sie dringt sogar in das Innerste der Kirche vor, wo sich die dramatische Frage stellt: Hat Europa, hat unsere Zivilisation noch eine Zukunft? Steht die europäische und abendländische Zivilisation vor einem nicht mehr rückgängig zu machenden Untergang, ist sie todkrank oder kann sie ihr Leiden überwinden? Gibt es die Möglichkeit, dass Europa wiederaufersteht?
Fünfzig Jahre nach dem Tod Pius XII.
Die Antwort gibt uns fünfzig Jahre nach seinem Tod die Stimme des Dieners Gottes Pius XII., dieses großen Papstes, dessen Seligsprechung Benedikt XVI. bereits in Aussicht gestellt hat.[3]
Am Ende seiner ersten, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erschienen Enzyklika Summi Pontificatus hat Pius XII. die tiefere Natur der Übel angeprangert, die damals die internationale Gemeinschaft bedrängten, und als Lösung auf die Rückkehr zur natürlichen, christlichen Ordnung hingewiesen.
An der Spitze dieses Werkes der Evangelisierung der Gesellschaft sollte nach Pius XII. eine neue Führungsschicht stehen, die sich zu einem großen Teil aus dem Adel und den traditionellen Eliten zusammensetzen sollte. An diese richtete der Papst 1946 bis 1957 einen systematischen Appell in seinen jährlichen Ansprachen an das Patriziat und den Adel von Rom. In seiner Ansprache vom 14. Januar 1945 hatte er bereits gemahnt: „Man kann heute sagen, dass es die ganze Welt wiederaufzubauen gilt: Die Weltordnung muss wiederhergestellt werden. Die materielle Ordnung, die geistige Ordnung, die moralische Ordnung, die gesellschaftliche Ordnung, die internationale Ordnung – alles muss umgestellt und in eine regelmäßige, beständige Bewegung gebracht werden. Diese von der Ornung ausgehende Ruhe ist der Frieden, der einzig wahre Frieden, und dieser kann nur dann wiedererstehen und von Dauer sein, wenn die menschliche Gesellschaft auf Christus aufgebaut ist, in dem alles vereinigt, zusammengefasst und zusammengeführt werden muss: Instaurare omnia in Christo (Eph 1,10)“.[4]
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira hat wie wenige die Bedeutung und Aktualität der Ansprachen Pius XII. erfasst und sie deshalb in einem Buch zusammengetragen und mit seinen Kommentaren vertieft. Dieses Werk ist von 1993 an in Italienisch und anderen Sprachen erschienen und liegt nun heute auch auf Deutsch vor. Die fünfzehn Jahre, die seit der Erstveröffentlichung vergangen sind, haben seine Aktualität und seine Voraussicht nur noch größer werden lassen.
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira meint dazu: „Wer die Verlautbarungen des Papstes liest, kann ohne weiteres erkennen, dass es ihm darum ging, dieser ungeheuren Revolution mit ihrem Gegenteil, das heißt mit der Gegenrevolution zu begegnen, einer Gegenrevolution, die viele Traditionen vor dem Ruin bewahren sollte und manchen anderen, die trotz ihrer Hinfälligkeit durchaus noch ihre Daseinsberechtigung haben, die Möglichkeit geben sollte, sich zu erheben und zu neuem Leben zu erwachen.“[5]
Der Naturalismus und der Aufbau der modernen Zivilisation
Als Revolution hat Plinio Corrêa de Oliveira in Übereinstimmung mit dem Lehramt der Kirche den Prozess der Entchristlichung definiert, der seit vielen Jahrhunderten gegen die abendländische Zivilisation angeht. Die wichtigsten Etappen dieses Prozesses wurden vom Humanismus und dem Protestantismus, von der Aufklärung und der Französische Revolution, dem Kommunismus und den Totalistarismen des 20. Jahrhunderts gebildet. Sie alle werden von dem roten Faden des Stolzes durchzogen, mit dem der Mensch versucht, Gott seine Rechte über die Gesellschaft abzusprechen.
In den Geschichtsphilosophien des 18. Jahrhunderts, wie etwa im Idealismus und im Positivismus, steht allein der Mensch im Mittelpunkt des Kosmos. Mit seiner Vernunft und seinem Willen erhebt er den Anspruch, die Natur zu beherrschen und die Geschichte zu ihrem Ziel zu führen. Indem sie all ihr Vertrauen auf das Individuum setzt, wie zum Beispiel in ihrer liberalen Phase, oder aber auf die Kollektivität, wie in ihrer sozialistischen Phase, vergöttert die Revolution den Menschen und verlässt sich auf eine Möglichkeit der „Selbsterlösung“ in und durch die Geschichte. Der Gedanke des Fortschritts als notwendiges Gesetz der Geschichte bildet das „Dogma“, auf dem der Gedanke der Modernität beruht.
Im 19. Jahrhundert tritt der von Marx und Lenin vertretene „wissenschaftliche Sozialismus“ als das Werkzeug auf, mit dem sich das neue Gebäude der modernen Zivilisation errichten lässt, deren Symbole die Megalopolen und Fabrikschornsteine darstellen. Die neue „Zivilisation der Arbeit“ würde nach der marxistischen Utopie endlich eine anarchische, egalitäre, klassenlose Gesellschaft errichten. Die Menschheit hat für diese Utopie einen schrecklichen Preis zahlen müssen: Kriege, Revolutionen, hunderte von Millionen Opfer auf der ganzen Welt. Niemals war so oft von Fortschritt und Menschenwürde die Rede, und niemals ist im Lauf der Geschichte so viel Blut geflossen, um dem Fetisch der Modernität ein wahres Brandopfer darzubringen.[6]
Der Fall der Berliner Mauer (1989) und der Twin Towers von New York (2001) wurde zum Ausdruck des symbolischen Zusammenbruchs des revolutionären Naturalismus. Auf dem Weg vom Humanismus zum Marxismus wollte die Revolution in ihrem Stolze eine selbständige natürliche Ordnung errichten, die weder Gott noch seine Gnade braucht. Der Bankrott der naturalistischen Utopie hat dann allerdings zu einem Projekt mit gegenteiligem Vorzeichen geführt.
Dem Konstruktivismus des 20. Jahrhunderts wird in unseren Tagen die Dekonstruktion entgegengesetzt, die aus den Theorien der Fahnenträger des „schwachen“ oder „postmodernen“ Denkens hervorgegangen ist. So wie die Revolution gestern die christliche Zivilisation im Namen einer auf den selbsterlöserischen Kräften des Menschen errichteten Zivilisation geleugnet hat, so leugnet diese heute selbst die Möglichkeit des Menschen, irendeine Art von Zivilisation aufzubauen. Der Feind ist nun nicht mehr die übernatürliche Ordnung, sondern die natürliche Ordnung. Heute geht es der Revolution darum, ein Projekt völliger Dekonstruktion der menschlichen Natur und ihrer Gesetze durchzuführen.
Die menschliche Natur
Was aber ist die menschliche Natur? Nach den Worten des heiligen Thomas ist Natur „das das auf die Funktion des Dinges selbst ausgerichtete Wesen eines Dinges“ (essentiam rei secundum quod habet ordenem ad propriam operationem)[7]. Die Natur ist das, was ein Seiendes ausmacht und ihm erlaubt, seinem Zweck entsprechend zu handeln. Im Falle des Menschen ist die Natur sein Wesen, d. h. das, was ihn zum Menschen und nicht zu etwas anderem macht. Diese Natur veranlasst den Menschen, nicht einfach allen Trieben seines Körpers nachzugeben, sondern sie nach einer Regel oder einem Gesetz zu ordnen und zu bestimmen. Mit den Tieren hat der Mensch seine physische Natur gemein, doch was diese von ihm unterscheidet, ist seine rationale Natur. Das Naturgesetz ist demnach nicht einfach das tierische Gesetz der Lebewesen, sondern die sittliche, metaphysische Ordnung des Geschöpfes, das der Mensch mit seiner Vernunft entdecken kann.
Die Natur trägt eine Grenze in sich, die besagt, dass einem Wesen unmöglich ist, etwas anderes zu werden, als das, was es ist. In dem Maße, in dem der Mensch versucht, die Grenzen seines eigenen Wesens und seiner Natur zu überwinden oder zu leugnen, verliert er die Fähigkeit, das ihm eigene Ziel zu verwirklichen. Wenn der Mensch aber sein Ziel aus den Augen verliert, strebt er danach zu werden, was er nicht ist: Er strebt ins Leere, er gerät in den Sog des Nichts. Damit steht der Nihilismus unvermeidlich am Ende der Verneinung des Naturgesetzes.
Die Legalisierung der Sünden gegen die Natur, wie dies etwa die Homosexualität und die Zulassung genetischer Versuche sind, müssen als ein dramatisches Beispiel dieser Zweckentfremdung des Menschen angesehen werden. Die in allen Zeitungen erschienene Nachricht vom sogenannten „schwangeren Mann“ lassen einen angesichts des dahinter steckenden Nihilismus erschaudern. In Oregon in den Vereinigten Staaten hatte eine homosexuelle Frau beschlossen, Mann zu werden. Mit Hilfe plastischer Operationen und Hormonbehandlungen hat sie zwar das Aussehen eines Mannes und den männlichen Namen Thomas Beatie angenommen, doch in ihrem Körper besitzt sie weiterin den weiblichen Fortpflanzungsapparat. Danach hat sie eine Frau geheiratet, die wie sie selbst homosexuell ist und von der sie natürlich keine Kinder bekommen kann. Sie beschloss also, sich an eine „Samenbank“ zu wenden. Aus der anonymen Befruchtung ist schließlich ein Mädchen hervorgegangen, das am 2. Juli 2008 auf die Welt kam. Dieses Mädchen hat eigentlich keine Eltern. Sein biologischer Vater ist ein anonymer Samenspender, während sein offizieller Vater in Wirklichkeit die biologische Mutter ist. Die offizielle Mutter ist nicht seine biologische Mutter, sondern die Lebensgefährtin des offiziellen Mutter-Vaters. Man kann sich schwerlich eine radikalere Leugnung der Naturgesetze vorstellen.
Nachrichten dieser Art lösen zwar noch Abscheu aus, doch bilden sie die Spitze eines Prozesses, dessen Reichweite nur wenige durchschauen.
Pius XII. behauptet, dass der Staat und die Familie die Säulen der Gesellschaft und ihre grundlegenden Bestandteile bilden, weil sie ihren Ursprung in der Natur haben.[8] Der heute vorherrschende kulturelle und moralische Relativismus leugnet die Existenz einer naturgegebenen, konstitutiven gesellschaftlichen Wirklichkeit. Für das Europa ohne Grenzen, das 1992 mit dem Vertrag von Maastricht geboren wurde, haben nicht allein die geographischen Grenzen und die wirtschaftlichen und politischen Barrieren zwischen den Staaten zu fallen, sondern auch die natürlichen Identitätsunterschiede, angefangen bei dem ersten und größten von allen, dem Unterschied zwischen Mann und Frau.
Mit dem Abkommen von Lissabon, das am 13. Dezember 2007 von den Staats- und Regierungschefs der 27 Länder unterzeichnet wurde, die die Europäische Union bilden, wird die am 7. Dezember 2000 in Nizza verabschiedete Charta rechtskräftig. In dieser Charta wird nicht nur jeder Hinweis auf die christlichen Wurzeln Europas ausgeklammert, sondern auch der Versuch gemacht, diese Wurzeln, die ja nicht nur historischer, sondern grundlegender Natur sind, völlig auszurotten.
Der Artikel 21 der Rechtecharta von Nizza, der der Vertrag von Lissabon obligatorischen Charakter verleiht, gibt in juristischer Sprache und unter der Bezeichnung eines Nichtdiskriminierungsprinzips die sogenannte „Gender-Theorie“ zum Ausdruck, die das biologische Geschlecht von der sexuellen „Neigung“ oder „Geschlechtsidentität“ unterscheidet. Demnach soll sich der Unterschied zwischen Mann und Frau nicht mehr auf das objektiv von der Natur Gegebene stützen, sondern auf die subjektive Neigung und Wahl.
Es geht hier nicht etwa um einen Grenzfall. Das Naturgesetz wird in einer von einem großen Teil der europäischen Staats- und Regierungschefs unterzeichneten Urkunde in seiner Wurzel geleugnet.
In einem großen europäischen Land, nämlich im Spanien Zapateros, hat das Parlament einen Gesetzesentwurf gutgeheißen, der im Namen des Nichtdiskriminierungsprinzips einige Menschenrechte, angefangen mit dem Recht auf Leben, auf die Menschenaffen (Schimpanzen, Gorillas und Orang-Utas) ausdehnt, genau das Recht auf Leben also, das man andererseits den Embryos abspricht. Auch hier handelt es sich nicht um einen Extremfall, sondern um den Versuch, etwas als normal anzusehen, was allen natürlichen und sittlichen Normen widerspricht.
Der Posthumanismus der IV. Revolution
Auf den wenigen, jedoch prophetischen Seiten, die Prof. Plinio Corrêa de Oliveira als Nachwort zur italienischen Ausgabe von Revolution und Gegenrevolution (1977) geschrieben hat, werden all die Elemente aufgezählt, die zum Verständnis des Prozesses notwendig sind, der die Vierte Revolution ausmacht. Der Postkommunismus nimmt nun die Gestalt eines Posthumanismus an. Bei dieser Vision geht es um die Überwindung des Menschen und um den Übergang vom alles umfassenden Humanismus zur umfassenden Zerstörung des menschlichen Subjekts.[9]
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Plinio Corrêa de Oliveira die heraufziehende IV. Revolution beschrieben hat. Heute geben Wissenschaften wie die Neuropharmakologie, die Gentechnik oder die Nanotechnik den Handwerkern des Nichts neue Mittel in die Hand, damit sie ihre tribalen Szenarien verwirklichen können. [10]
Außer der Unterscheidung zwischen Mann und Frau wird auch die zwischen der Menschen-, der Tier- und der Pflanzenwelt hinfällig, ja sogar der Unterschied zwischen den organischen und den anorganischen Daseinsformen. Die radikale Ökologie spricht von einem kosmischen Egalitarismus, der auch die Bestandteile der Natur wie die Berge, die Pflanzen, das Wasser, die Atmosphäre und die Landschaften einbezieht. Es handelt sich hier um eine pantheistische Weltanschauung, nach der das Universum aus einem unermesslichen Gewebe von Beziehungen besteht, sodass jedes Wesen durch ein anderes lebt und sich die Gottheit als das „Selbstbewusstsein“ des Universums herausstellt, das sich, indem es sich entwickelt, seiner eigenen Entwicklung bewusst wird.[11]
Das Prinzip der „Nichtdiskriminierung“ hebt die philosophische Grundlage der abendländischen, christlichen Zivilisation aus den Angeln, nämlich das Prinzip der Identität und der Nichtwidersprüchlichkeit. Die Nichtdiskriminierung hebt in Wirklichkeit die Identität auf, sie bedeutet die Hybridisierung und Verschmelzung dessen, was wesentlich verschieden ist. Es handelt sich um ein Merkmal, das uns stets in gnostischen und pantheistischen Systemen begegnet.
In dieser posthumanen Perspektive wird auch der Unterschied zwischen Mensch und Maschine hinfällig. Der Gedanke einer Symbiose von Mensch und Maschine hat vor allem mit der Entwicklung der Informations- und Digitaltechnik an Boden gewonnen. Der Begriff Cyborg wird auf neue Hybriden angewandt, unter denen man Menschen versteht, die durch den Zusatz von mechanischen Prothesen oder technischen Komponenten verändert wurden. Vor allem der Einsatz der Nanotechnik erlaubt möglicherweise die Einführung von miteinander verbundenen winzigen Nanorobotern in den Blutkreislauf oder ins Gehirn, wo sie sich zu einer Art künstlicher Intelligenz zusammenschließen können, d. h.„zu einem echt hybriden Wesen aus biologischer und nichtbiologischer Intelligenz“.[12]
Anders als der Cyborg mit seinen biologischen und künstlichen Teilen ist der Androide nichts als ein Roboter mit menschlichem Aussehen oder ein künstlich zusammengebauter Mensch. Ein menschliches Wesen dieser Art wurde zum ersten Mal in dem Roman Frankenstein von Mary Shelly (1818) beschrieben, der oft als der erste Science-fiction-Roman angesehen wird. Heute aber sind die Versuche des Dr. Frankenstein nicht mehr nur Literatur, sondern Wirklichkeit.[13]
Prof. Aldo Schiavone, ein postkommunistischer italienischer Intellektueller, widmet ein Kapitel seines jüngsten BuchesGeschichte und Schicksal dem Thema „über die Art hinaus“. Darin weist er darauf hin, dass wir in Zukunft „nicht mehr von unseren natürlichen Grenzen bestimmt sein werden, sondern von der Tatsache, dass wir diese überwunden haben“[14]. Zu den Grenzen, die der Mensch überwinden wird, zählt Schiavone sogar den Tod: „Ich bin davon überzeugt, dass meine Generation und die unserer Kinder die letzten sein werden, die noch mit der Erfahrung des Todes, so wie er unserer Art bisher begegnet ist, rechnen müssen.“[15]
Diese endlose Transformation soll den Menschen „über den Menschen hinaus“ führen und so den Bestand und die Dauerhaftigkeit seiner Natur auflösen.
Der Feind, den die Revolution heute besiegen will, ist der von Gott geschaffene Mensch. Der naturgegebenen, christlichen Ordnung wird eine zutiefst anti-natürliche und anti-christliche Ordnung entgegengestellt.
Menschliche Natur und Adel
Benedikt XVI. hat zu Recht hervorgehoben, dass „in letzter Zeit jede juristische Regelung sowohl auf interner als auch auf internationaler Ebene ihre Legitimation von der Verwurzelung im Naturgesetz herleitet“[16], und dass „kein von den Menschen aufgestelltes Gesetz die vom Schöpfer ins Herz des Menschen gelegte Norm umstürzen darf, ohne dass die Gesellschaft selbst auf dramatische Weise in ihrer unverzichtbaren Grundlage erschüttert würde“[17].
Die Verteidigung des Naturgesetzes beschränkt sich jedoch nicht allein auf den theoretischen und begrifflichen Aspekt. Die menschliche Natur verteidigt sich auch selbst, indem sie naturgemäß lebt, das heißt in Übereinstimmung mit einem allen Menschen gemeisamen unveränderlichen, ewigen Gesetz. Wer sich in seiner Lebensweise an die Natur und die Vernunft hält, lebt edel. „Adel ist die Vollkommenheit der Natur selbst in allen Dingen“, behauptet Dante im IV. Abschnitt seines Gastmahls[18]. Der Adlige lebt nach der Perfektion der Natur selbst, die die menschliche Natur in Benehmen, Umgang und Sprache erhebt.
Es ist keineswegs nicht verwunderlich, dass Plinio Corrêa de Oliveira sein letztes Werk dem Adel und den traditionellen Eliten[19] gewidmet hat, handelt es sich doch um eine klare Botschaft und einen deutlichen, an den Westen gerichteten Appell in dieser Richtung.
Der Adel hat oft die guten Sitten und den Gebrauch der gesellschaftlichen Beziehungen bewahrt, dabei aber ihren tieferen Sinn aus den Augen verloren. Es ist daher notwendig, diesen gesellschaftlichen, menschlichen Beziehungen ihre eigentliche Bedeutung zurückzugeben. Natürlich braucht der Adel, um überleben zu können, wirtschaftliche und politische Kraft, doch Macht und Finanzmittel bedürfen zu ihrer Legitimierung einer vom Dienst am Gemeinwohl inspirierten Weltanschauung. Plinio Corrêa de Oliveira hat das Wesen des Adels und der traditionellen Eliten im Dienst am Gemeinwohl gesehen, und dieser Dienst wird auf dem Wege der unblutigen Übernahme von Pflichten und Verantwortung in die Tat umgesetzt.
Der Hauptgrund für die Geburt des Adels lag in der Verteidigung der bedrohten Gesellschaftsordnung in den finsteren Jahrhunderten, die zwischen dem Niedergang Roms und dem Licht des Mittelalters lagen.
Damals erfüllte er seine Aufgabe vor allem durch die Übung kriegerischer Tugend, die Mut, Kampfgeist, Todesverachtung und Ehrgefühl voraussetzt. Unter all diesen Gefühlen nimmt sicherlich das Ehrgefühl den vornehmsten Platz ein, denn dieses macht gewissermaßen das Wesen des Adels aus. Ehre hat nichts mit Eitelkeit oder Stolz zu tun. Ehre setzt vielmehr eine gewisse Demut voraus, denn allein die Demut macht uns von uns selbst los und lässt uns große Dinge vollbringen. Der Grad an Adel eines Menschen wird an seiner Fähigkeit gemessen, sich von den materiellen Dingen zu befreien, obwohl er mitten im Reichtum lebt.
Der Ausdruck „Ehrenwort“ sollte uns zum Nachdenken anregen. Die Verbindung dieser beiden Begriffe, Wort und Ehre, bringt die Kraft des Wortes, seine heilige Natur zum Ausdruck. Die Unveränderlichkeit des Ehrenwortes weist nicht nur auf eine religiös sakrale Dimension hin, die an das schöpferische Wort Gottes erinnert, sondern verweist auch auf eine philosophische Dimension. Sie bestätigt das Prinzip, auf dem das christlich-abendländische Denken beruht, nämlich das Prinzip der Identität und des Widerspruchs, wonach sich das, was sich selbst gleich ist, nicht ändert. Mit einem Wort, das metaphysische Prinzip der Fortdauer der Tradition.
Das Ehrenwort schließt nicht nur eine Metaphysik, sondern auch eine auf die menschliche Person gegründete Anthropologie ein. Ehre heißt Achtung sich selbst und den andern gegenüber. Sie geht von der Überzeugung aus, dass der Mensch vor allem Person ist. Sie besteht aus dem Gefühl, dass es etwas Höheres gibt als das eigene Vergnügen und Interesse. Wer ein edles Gemüt besitzt, hebt sich von den niederen, vulgären Dingen ab, steht über ihnen. Diese Sicht ist nicht zoologisch ausgerichtet, sondern geistig. Sie ist dem Menschen eigen, der weiß, dass das materielle Leben nicht das höchste Gut darstellt. Man kann zwar Ehrgefühl haben, auch wenn man religiösen Fragen skeptisch gegenübersteht, wer jedoch einen tiefen Glauben an Gott besitzt, kann niemals das Ehrgefühl entbehren.
In Deutschland ist 1994 ein schönes Buch von Marion Gräfin Dönhoff (1909-2002) unter dem Titel Um der Ehre willen[20] erschienen. Die Verfasserin, eine preußische Aristokratin mit fortschrittlichen Ideen, Mitherausgeberin der Wochenzeitung „Die Zeit“, beschreibt darin Erinnerungen an ihre Jugend sowie die kulturelle und gesellschaftliche Atmosphäre, in der die Gedanken und Gefühle entstanden sind, die zum Attentat des Grafen Klaus Schenk von Stauffenberg gegen Hitler geführt haben. Der Widerstand des deutschen Adels gegen den Nationalsozialismus hatte seine Wurzel vor allem im Ehrgefühl. Es ging hierbei nicht um irgendeine Sehnsucht nach der Vergangenheit. Gräfin Dönhoff schreibt in ihren Lebenserinnerungen, dass die höchste Form von Liebe vielleicht die sei, die sich auf das richtet, was uns nicht mehr angehört.
Das scheinbar mit den Jahrhunderten des Rittertums untergegangene Ehrgefühl erweist sich in Zeiten des Verfalls besonders lebendig und nährt sich aus den geistigen Quellen einer Menschennatur, die sich im Laufe der Jahrhunderte nicht verändert.
Heute ist ein Plan im Gange, der die Zerstörung der menschlichen Natur zum Ziele hat und damit beginnt, dass theoretisch die Existenz einer bleibenden, unveränderlichen Natur des Menschen geleugnet wird. Am Ende führt dies zur Schaffung eines gespaltenen, aufgelösten Menschentyps, der keine Identität und keine Erinnerung mehr hat, wie etwa die entwurzelten jungen Menschen, die wir in unseren Banlieux finden. Der Adel kann heute seine Sendung in der Verteidigung und in der Wiederherstellung der menschlichen Natur wiederfinden und damit dem Aufruf folgen, der gestern von Pius XII. und in unseren Tagen von Benedikt XVI. nicht nur an die Katholiken, sondern an alle Menschen guten Willens und jeden Glaubens gerichtet wurde.
Die Wiederherstellung der menschlichen Natur beginnt mit der Behauptung eines Naturgesetzes, die auf der Beständigkeit der menschlichen Natur gründet, und findet ihren Abschluss in der Wiederentdeckung eines edlen, erhabenen Menschentyps, der seine Wurzeln im Gedächtnis und in der Tradition hat. Dieser Menschen wird vor allem das Ehrgefühl zurückgewinnen und mit ihm eine Haltung, die die Jahrunderte überdauert hat und die weder an den Besitz von Ländereien, noch an den Einsatz von Pferden und den Gebrauch von Waffen gebunden ist.
Der Mensch kann sich erheben, kann sich aber auch erniedrigen, wenn er nämlich nicht dem Vernunftgesetz seines Geistes, sondern dem biologischen seiner Instinkte folgt. Dem edlen Menschentyp steht dann das Bild des modernen und postmodernen, seelisch aufgelösten, seiner Identität und Wurzeln baren Menschen gegenüber.
So ist es also notwendig, das Naturgesetz zu kennen und zu lieben und auf edle Weise nach der Natur zu leben. Doch das ist nicht genug. Gott hat dem Menschen ein übernatürliches Ziel angewiesen und Jesus Christus ist Mensch geworden und hat bis zum Tod gelitten, um die gefallene menschliche Natur zu erlösen. Um dem Naturgesetz folgen zu können, bedarf es des übernatürlichen Lebens der Gnade, denn allein der Christ kann in seinem Leben die Natur zur Vollkommenheit bringen. Deshalb darf sich der Christ nicht mit einer allein auf das Naturgesetz gegründeten Gesellschaft zufriedengeben. Sein Wunsch muss die Bekehrung der ganzen Welt zum Christentum sein.
Aus diesem Grunde geht es uns nicht allein darum, die natürliche Ordnung zu verteidigen, sondern es geht uns um eine natürliche christliche Ordnung. Wir begnügen uns nicht mit dem natürlichen Sittengesetz, sondern streben das natürliche christliche Sittengesetz an.
Darum wollen wir die Wiedererstehung einer durch und durch christlichen Gesellschaft, denn wir sind uns bewusst, dass die Natur ohne das Christentum verfällt, so wie auch die Gnade ohne die natürliche Ordnung nicht gedeihen kann, denn die Gnade setzt – nach den Worten des heiligen Thomas – die Natur voraus.[21] Das Gnadenleben setzt die Beachtung des Naturgesetzes voraus.
Deshalb bitten wir die Kirche um das Leben der Gnade, das sie uns in ihren Sakramenten, besonders aber in der Eucharistie schenkt. Und wir erbitten es von der Gottesmutter, der Mittlerin aller Gnaden.
Wir haben uns heute hier eingefunden, um die Veröffentlichung eines Buches zu begrüßen, das uns den Anstoß zu tiefem Nachdenken gibt und uns zum Handeln einlädt. Ein Buch, das als Autoren zwei große Protagonisten des 20. Jahrhunderts zusammenführt: Eugenio Pacelli, der als Papst den Namen Pius XII. trug und dessen Todestag sich am 8. Oktober zum fünfzigsten Mal gejährt hat, und Plinio Corrêa de Oliveira, dessen Geburtstag sich am 13. Dezember zum hundertsten Mal jähren wird. Vom Himmel aus führen sie heute ihre und unsere Schlacht gegen die Revolution weiter.
[1] Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Artemis und Winkler, Düsseldorf – Zürich 2002 (1994).
[2] Geopolitik des Chaos ist der Titel zweier Bücher von Beobachtern des internationalen Panoramas: I. Ramonet in Frankreich (Géopolitique du chaos, Gallimard, Paris 1999) und C. Jean in Italien (Geopolitica del Caos, Franco Angeli, Milano 2007).
[3] In der Ansprache Benedikt XVI. zum fünfzigsten Todestag Pius’ XII. am 9. Oktober 2008.
[4] Pius XII, Allocuzione al Patriziato e alla Nobilità Romana del 14 gennaio 1945, in Discorsi e Radiomessaggi, Bd. VI, S. 273.
[5] Plínio Corrêa de Oliveira, Pio XII: grandi orizzonti e mezzi straordinari per la restaurazione dell’ordine sociale cristiano, in „Lepanto“, Nr. 134, Sept.-Okt. 1993.
[6] Roberto de Mattei, 1900-2000: Due sogni si succedono. La costruzione, la distruzione, Edizioni Fidúcia, Roma 1989.
[7] Thomas von Aquin, De Ente et Essentia, I, 3.
[8] Pius XII., Discorso del 20 febbraio 1946, in Discorsi e Radiomessaggi, Bd. VII, S. 393f.
[9] P. Corrêa de Oliveira , Rivoluzione e Contro-Rivoluzione vent’anni dopo, in Rivoluzione e Contro-Rivoluzione,Cristianità, Piacenza 1977, S. 190f.
[10] Vgl. Francis Fukuyama, L’uomo oltre l’uomo. Le consguenze della rivoluzione biotecnologica, ital. Ausgabe, Mondadori 2002; David Jay Brown, Riflessioni sull’orlo dell’Apocalisse, ital. Ausgabe, Mondadori, Milano 2006.
[11] Vgl. Zum Beispiel Leonardo Boff, Ethos mundial. Um consenso mínimo entre os humanos, Letraviva, São Paulo 2000, S. 198.
[12] Raymond Kurzweil, Verso un’intelligenza superiore, in Riflessioni sull’orlo dell’apocalisse, S. 194 (183-207). Ders., The Singularity is Near: When Human transcured Biology, Viking, New York 2005.
[13] Hans Moravec, Mind Children. The Future 0f Robot and Human Intelligence, Harvard University Press, Cambridge (Ma) 1988; Robot: mere machine to transcendent wind, Oxford University Press, Oxford-London 1998.
[14] Aldo Schiavone, Storia e destino, Enaudi, Torino 2007, S. 56-77, 69.
[15] Ibid., S. 75.
[16] Benedikt XVI.in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Kongresses über das naturgegebene Sittengesetz vom 12. Februar 2007.
[17] Benedikt XVI. in seiner Ansprache an die Mitglieder der internationalen theologischen Kommission vom 5. Oktober 2007.
[18] Dante Alighieri, Gastmahl, IV, XVI, 4.
[19] Plínio Corrêa de Oliveira, Nobilita ed elites tradizionali analoghe nelle collocazioni di Pio XII al Patriziato e alla Nobilità romana, Marzorati, Milano 1993.
[20] Marion Gräfin Dönhoff, Um der Ehre willen. Erinnerungen an die Freunde des 20. Juli, Doldmann, München 1996.
[21] Hl. Thomas von Aquin, Scriptum super sententiis, lib. 4, d2.
Graf von Proenca-a-Velha

Buchvorstellung im Portugal, Estoril Palace Hotel am 1. November 1994: Der Graf von Proença-a-Velha hält die portugiesische Ausgabe des Buches ‘Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten’ in der Hand während der Herzog von Maqueda etwas erklärt.
Dieses Buch scheint mir als wäre es ein Hauch von Gott.
Es macht uns verantwortlich nicht nur für das, was wir sind sondern auch für das, was wir sein und tun sollen. Ich wage zu sagen, es ist das Evangelium des Adels.
Graf von Proenca-a-Velha
(Kommentar des Grafen bei einer Diskussion in Portugal über Adel und analoge traditionelle Eliten)
Die Herzöge von Maqueda
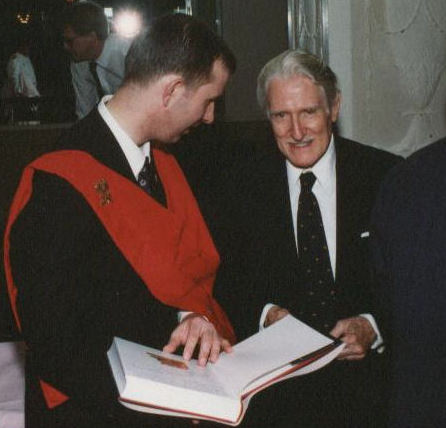
Präsentation des Buches ‘Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten’ im Hotel The Mayflower, Washington, D.C. am 28.9.1993. Der Herzog von Maqueda und der Vorstandsvorsitzende der Amerikanischen Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum – TFP.
Dieses Buch beantwortet Grundsatzfragen der Gesellschaft, die dem Menschen von heute wichtig sind. Es beschäftigt sich mit zwei verschiedenen Ansichten. Eine beruht auf der Annahme, daß gewisse harmonische Ungleichheiten zwischen verschiedenen sozialen Klassen in vollem Einklang mit der katholischen Lehre und den Grundsätzen der christlichen Zivilisation stehen.
Die andere geht davon aus, daß alle Ungleichheiten ungerecht sind und zu Klassenkampf mit den entsprechenden Folgen führen.
Wer sich für die erstere entscheidet, schließt sich der vorrangigen Option für die Armen an, die Papst Johannes Paul II. so wichtig war. Sie betrachtet aber auch die Existenz authentischer Eliten mit einer starken Verankerung in Religion und Familie als unentbehrlich.
Für den weltweit geschätzten brasilianischen Denker ist es äußerst wichtig, daß diese Erkenntnis in katholischen Kreisen, die heute unter einer Autoritätskrise leiden, bewahrt wird. Diese Krise hat Papst Paul VI. veranlaßt zu sagen, daß „die Kirche sich in einer Zeit der Unruhe befindet. Einige üben Selbstkritik, die beinahe bis zur Selbstzerstörung geht;“ und man hat das Gefühl, daß „durch eine Bruchstelle ein satanischer Rauch in den Tempel Gottes eingedrungen ist.“
Wenn man den unbedingt notwendigen hierarchischen Charakter der Kirche, die von unserem Herrn Jesus Christus gegründet wurde, in Betracht zieht und deren Aufgaben zu lehren, zu weihen, die Gläubigen zu leiten, die der höchsten Autorität, dem Heiligen Vater übertragen wurden, muß man dem Autor Recht geben, daß eine Studie, die sich mit den wichtigsten päpstlichen Dokumenten zu diesen Fragen beschäftigt, für die Orientierung der Christen eine große Hilfe darstellt. Es gibt heute in der ganzen Welt ungefähr 880 Millionen Christen und kein einziger davon hat auch nur im Entferntesten das Ansehen und die Autorität des Nachfolgers des Heiligen Petrus.
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira hat es für notwendig erachtet, den gläubigen Christen unbeschadet der vorrangigen Option für die Armen auch eine vorrangige Option für den Adel nahe zu bringen. Das hat ihn veranlaßt, die vierzehn großartigen Ansprachen gründlich zu studieren, die Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom richtete und mit überzeugender Klarheit feststellte, was Adel bedeutet und welche Aufgaben er zu erfüllen hat.
Gleichzeitig weist Papst Pius XII. darauf hin, daß der Adel die Türen für neue Klassen, die in der heutigen Welt infolge sozialer und ökonomischer Veränderungen entstehen, offen halten soll, so daß sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit diesen Klassen ergeben.
Der Adel muß allmählich auch diese Klassen zu echten Eliten heranziehen, indem er den „Neureichen“ hilft, ihre intellektuellen und moralischen Defizite auf das hohe Niveau der Tradition zu bringen. Umgekehrt sollen die neuen Gruppen, dankbar für die Gaben des Geistes, die sie erhalten haben, zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft eifrig bemüht sein, sich anzupassen, um analoge Eliten zu werden anstatt feindliche Rivalen.
Wir vertrauen darauf, daß die Ansprachen Papst Pius XII., die der Autor wissenschaftlich mit Zitaten anderer Päpste, des Hl. Thomas von Aquin und anderer Kirchenlehrer ergänzt, dem spanischen Adel helfen werden, seine Identität zu bewahren und in den Lehren Pius XII. eine klare Definition seines Auftrages und seiner Daseinsberechtigung in der heutigen Zeit zu finden. Aus diesem Grund wird man die aufschlußreichen und mutigen Kommentare dieses Autors besonders schätzen.
Gestatten Sie uns, abschließend mit Prof. Plinio Corrêa de Olivera zu betonen, daß laut Papst Pius XII. das Festhalten am Glauben, die Einhaltung der Gebote und ein Leben in Frömmigkeit mit regelmäßigem Empfang der Sakramente Grundbedingungen sind für den Adel und analoge Eliten, um ihre Aufgaben in beispielhafter Weise erfüllen zu können. Ohne diese übernatürlichen Kräfte kann und wird kein Apostel irgendetwas erreichen.
Christus heri et hodie, initium et finis, alpha et omega, ipsius sunt tempora et saecula, ipsi gloria et imperium, per universa aeternitatis saecula (aus der Liturgie der Osterzeit)
Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega, Sein ist Zeit und Ewigkeit, Sein ist Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit.
Das ist die große Wahrheit, ohne die niemand in diesem Leben, den Weg zu einer christlichen Ordnung auf dieser Welt und zum ewigen Heil finden wird.
Die Herzöge von Maqueda
(Auszug vom Vorwort der spanischen Ausgabe von „Adel und analoge traditionelle Eliten).
Fr. Raimondo Spiazzi, O.P.

Sehr geehrter Herr Professor,
ich habe Ihr Buch “Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und den Adel von Rom“, das Sie mir freundlicher Weise gesandt haben, aufmerksam gelesen.
Ich halte es für eine glückliche Idee, diese Dokumente von Papst Pius XII., die auf den ersten Blick keinen Bezug zur heutigen Zeit haben, bekannt zu machen. Ihre klaren und dokumentierten Kommentare zu diesem Thema zeigen jedoch den Weitblick des großen Papstes. Weiters erinnern Sie zur rechten Zeit an die schönen Worte von Papst Paul VI.: „Wir würden ihnen gerne so viel sagen. Ihre Gegenwart regt zum Nachdenken an. Das bezieht sich auch auf unsere ehrwürdigen Vorgänger, besonders Papst Pius XII. … Wir wollen glauben, daß das Echo dieser Worte wie eine Böe, die die Segel aufbläht …. in ihren Gedanken weiter schwingt und sie die Berufung erkennen, die die Vorsehung für sie bestimmt hat und den Rang einnehmen, der in der heutigen Gesellschaft von ihnen erwartet wird.“
Als Professor, Abgeordneter im Kongreß und als ein in der Öffentlichkeit stehender Mann mit langjähriger Erfahrung haben Sie intelligente und aufschlußreiche Kommentare verfaßt, die das Lesen der päpstlichen Dokumente erleichtern und verständlicher machen.
Auf keiner Seite Ihres Werkes habe ich einen einzigen Fehler in theologischer oder anderer Hinsicht in Bezug auf die Lehren der Kirche gefunden. Ich kann nur hoffen, daß Ihr hervorragendes Buch eine breite und herzliche Aufnahme findet.
Fr. Raimondo Spiazzi, O.P.
Angesehener italienischer Theologe
Fr. Victorino Rodriguez, O.P.
Lieber Freund und verehrter Professor,
ich habe das Original Ihres großartigen Werkes „Der Adel und die vergleichbaren traditionellen Eliten in den Ansprachen von Papst Pius XII. an das Patriziat und an den Adel von Rom“, das Sie mir freundlicherweise zur Durchsicht gesandt haben, aufmerksam gelesen. Durch Ihr Vertrauen ín meine Beurteilung und ev. Anmerkungen fühle ich mich geehrt. Ich verstehe Ihren Wunsch, daß die Herausgabe eines solchen bedeutenden Werkes gut begründet sein soll und bewundere Ihre Bescheidenheit, indem Sie die Meinung von jemandem einholen, der auf diesem Gebiet weit geringere Kenntnisse hat als Sie sowohl in lehrmäßiger als auch historischer Hinsicht.
Ich muß sagen, daß ich absolut nichts gefunden habe, was zu kritisieren oder zu verbessern wäre. Besonders möchte ich hervorheben, was ich als sehr gut betrachte:
Erstens, daß Sie ein Buch über dieses Thema schreiben. Das war mehr als nötig. Auch der Zeitpunkt war richtig gewählt.
Dieser außergewöhnliche Papst Pacelli. dessen Geist, Herz und Blut adelig waren, hat sich besonders den Problemen und Erwartungen seiner Zeit gewidmet. Er machte sich Sorgen um den Adel, an den er seine Ansprachen richtete, aber er konnte ihm nicht helfen. Nun hat sich gerade zur richtigen Zeit ein brasilianischer Adeliger mit diesem Thema beschäftigt, einer, der sich durch Demut und Liebe zur christlichen Zivilisation auszeichnet.
Zweitens die Aktualität des Buches, da die echten Werte des Adels laufend in den Hintergrund gedrängt werden, und in den leblosen modernen Demokratien die post-revolutionäre Gleichmacherei vorherrscht. Stimmen oder Dollars sind heutzutage wichtiger als hervorragende Eigenschaften (Wissen, Tugend und Kunst). Aber ich hörte den großen Theologen Santiago Ramirez bei mehreren Gelegenheiten sagen: „Wahrheit ist nicht demokratisch aber aristokratisch“. Ich bin sicher, daß Ihr sorgfältig dokumentiertes, eindrucksvolles Werk den Adel wieder in die vorderste Reihe bringen wird als Träger von Würde, Ehre und Humanismus, offen für Gott und das Wohl der Gesellschaft.
Drittens glaube ich, daß Ihre harmonische Verbindung zwischen „vorrangiger Option für die Armen“, wie es in der neuen Evangelisation heißt, und „der vorrangigen Option für den Adel“ sehr gerecht und christlich ist. Diese beiden Auffassungen schließen einander nicht aus sondern ergänzen einander. Ich glaube, der Grundsatz sollte sein: den Besten mehr lieben und dem Ärmsten mehr helfen. Daraus resultieren die beiden vorrangigen Optionen. Die karitative Option für die Bedürftigen sollte die besondere Wertschätzung, die der Adel verdient, nicht beeinträchtigen. Sehr interessant ist die Information über den großen Prozentsatz an Heiligsprechungen von Adeligen. Es war Pius XII., der 1943 die Heilige Margareta von Ungarn, O.P. Tochter des Königs von Ungarn und Enkeltochter des Kaisers von Konstantinopel heilig gesprochen hat.
Viertens ist es nötig, im Zeitalter des Pazifismus (Frieden um jeden Preis), das Thema des gerechten Krieges aufzugreifen, den der Adel so oft zu führen gewagt hat, seien es militärische, kirchliche oder Bürgerkriege. Das Lehramt und die Theologie hatten und haben dazu viel zu sagen, woran uns das Kapitel Dokumente XI erinnern.
Fünftens ist es schließlich opportun, an die christliche Soziallehre zu erinnern in einer Zeit, in der die Demokratie ohne Verantwortungsbewußtsein und ohne Resolutionen in ethischen Belangen für viele das einzige politische Dogma darstellt. Im Päpstlichen Lehramt ist die hoch stehende Doktrin des Heiligen Thomas eingebaut, die so oft von katholischen Denkern aufgegriffen wird und jetzt auch von Ihnen im Anhang IV Ihres Werkes.
Ich könnte noch viele interessante Punkte Ihres Buches hervorheben, aber ich möchte diesen Brief nicht ungebührlich verlängern oder wiederholen, was der Leser viel treffender und ausführlicher dargestellt in Ihrem Buch finden wird. Mit diesen Bemerkungen hoffe ich, zum Ausdruck zu bringen, daß ich das Original mit Freude gelesen habe.
Fr. Victorino Rodriguez, O.P.
Angesehener spanischer Theologe
Fr. Anastasio Gutiérrez, C.M.F.
Mein lieber Freund Juan Miguel,
ich habe den Brief mit dem wunderbaren Werk von Prof. Plinio Corrêa de Oliveira,
Eurem verehrten Gründer, erhalten: „Adel und analoge traditionelle Eliten …“.Du hast mir ein sehr wertvolles Geschenk gemacht, ein Werk, dessen wissenschaftliche, historische, soziologische, menschliche und christliche Weisheit unschätzbar ist. Mit meinen 81 Jahren, davon 55 Jahre Lehrstuhl vorwiegend für sozialwissenschaftlich-juristische Studien und seit 50 Jahren in Rom glaube ich in der Lage zu sein, dieses Werk beurteilen zu können und es vor allem zu schätzen. Ich wiederhole: es ist ein Werk, das an Weisheit und gerechter Beurteilung von vielen anderen Büchern, die auch großartig sind, kaum erreicht werden kann, weil diesen das Charisma des großen Denkers, seine Kenntnisse und Erfahrungen fehlen. Abgesehen von der Dokumentation faszinieren mich vor allem die ausführlichen Erläuterungen durch Prof. Corrêa de Oliveira, die sich über Geschichte, Sozialpsychologie, Philosophie, Theologie und christliche Ethik mit Tiefblick und analytischer Fähigkeit erstrecken. Kurz gesagt, Professor Corrêa de Oliveira ist ein großer Meister, der es verdient, an der Spitze dieser elitären Klasse zu stehen.
Die Präsentation des Buches gleicht dem Inhalt. Wie das Thema des Werkes ist sie edel. Das Werk könnte durch die Erwähnung von Isabella der Katholischen eine weitere Aufwertung erfahren. Von großen Historikern wird sie, nach der Mutter Gottes, als die größte aus königlichem Geschlecht stammende Frau, die jemals gelebt hat, angesehen.
Sag ihm (Professor Corrêa de Olivera) auch, daß ich seinen Brief mit dem Ersuchen um Wiederaufnahme des Prozesses von Isabella der Katholischen, der vor mehr als zweieinhalb Jahren unterbrochen wurde, an den Papst weitergeleitet habe. Wie Du weißt, führt Professor Corrêa de Olivera die Liste der bedeutendsten Persönlichkeiten an, die ihre Heiligsprechung befürworten.
Möge das Buch die Verbreitung, die es verdient, erreichen. Wenn Du dem Autor schreibst, übermittle ihm meine Glückwünsche.
Meine besten Wünsche
in Zuneigung Dein Freund
Fr. Anastasio Gutiérrez, C.M.F
Weltweit geschätzter Theologe und Kanonist
(Auszüge aus einem Brief an Juan Miguel Montes, Direktor des Büros der TFP in Rom)
George Bordonove

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira ist ein vorausblickender Denker, der mit fast schmerzhafter Schärfe die sich im Gange befindliche Veränderung in der heutigen Gesellschaft erkennt, von der man nicht weiß, wohin sie führen wird. Er fürchtet, und das nicht ohne Grund, daß die Verknüpfung des galoppierenden Fortschritts mit einer falsch verstandenen Gleichmacherei möglicherweise die Individualität zerstören wird. Er stimmt in dieser Hinsicht mit dem Papst überein und fordert die Eliten, wenn sie nicht untergehen wollen, auf, nicht über verschwundene Größe zu klagen, sich nicht aus der Gesellschaft zurückzuziehen sondern resolut am aktiven Leben teilzunehmen, ihre Talente, ihr Erbe an Erfahrungen, ihre Familientraditionen und sogar ihre Lebensweise für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen….
Dieses Werk ist in jeder Hinsicht bemerkenswert, vor allem durch die reichhaltige und überaus exakte Dokumentation, vor allem durch die Allgemeinbildung des Autors, seine gründliche Beweisführung und die Transparenz seiner Gedanken. Der Leser wird auch davon beeindruckt sein, wie sich der Autor mit den Fragen der Zukunft auseinandersetzt ……. Er zeigt einen Weg auf, setzt Orientierungspunkte auf diesem Weg, der beschritten werden soll.
Ist das (das Werk) die Ankündigung des Weges für das 21. Jahrhundert, das, wie man sagt, entweder mystisch oder überhaupt nicht mehr sein wird?
George Bordenove
Weltweit geschätzter französischer Historiker
(Auszug aus dem Vorwort zur französischen Ausgabe dieses Buches)
Paul M. Weyrich
„Ihr Buch kann helfen, die Menschen aufzurütteln, um eine Elite aufzubauen, die dem Wohl der Gesellschaft dient.
Paul. M. Weyrich
eh. Präsident der Free Congreß Foundation (RIP)
Morton C. Blackwell
Durch Verwendung theologischer, moralischer und kluger Argumente wird dieses Buch viele Leser, was immer ihr Glaube sein möge, davon überzeugen, daß gute Eliten legitim, wünschenswert und unbedingt notwendig sind.
Morton C. Blackwell
President Leaderhip Institute